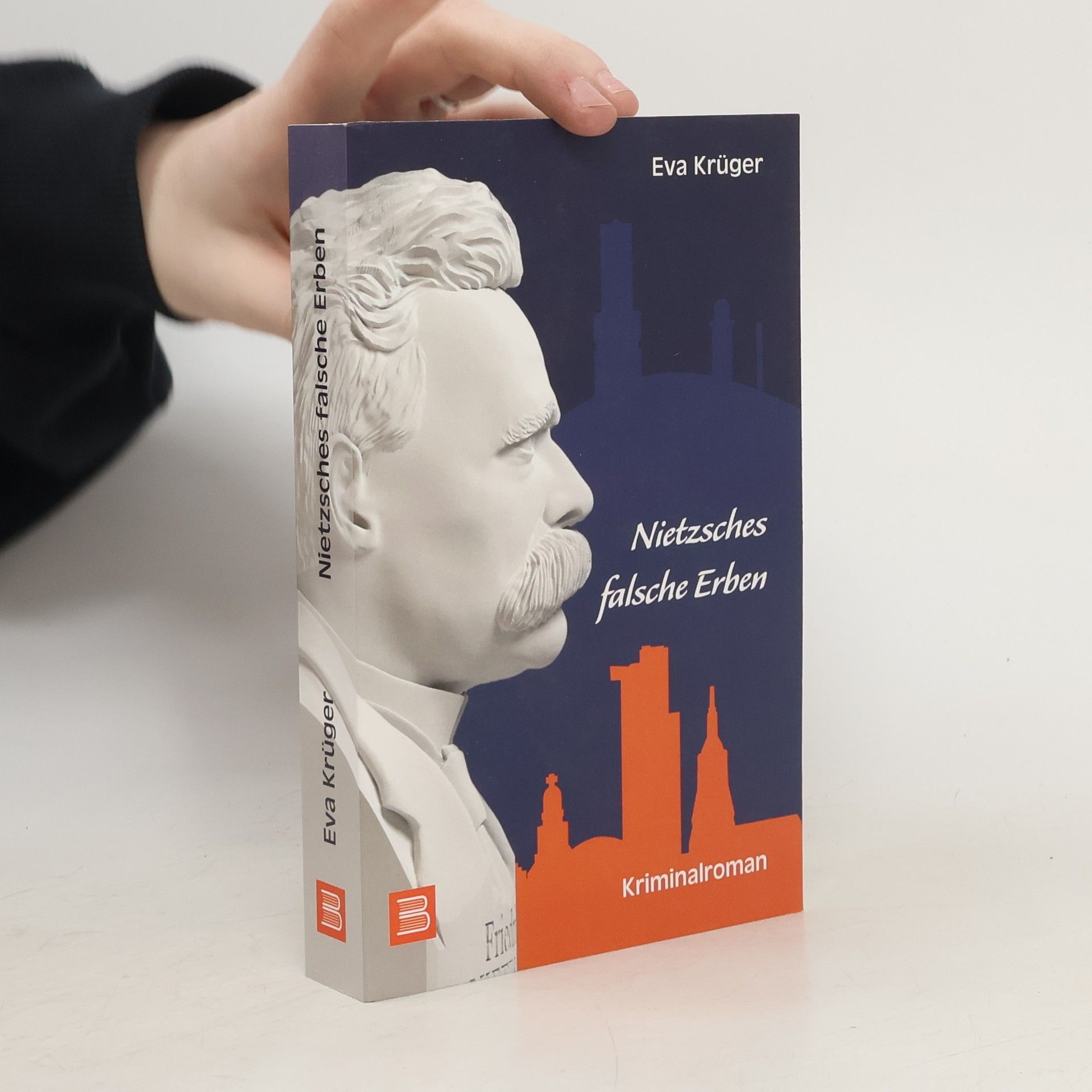Schopenhauers Fluch
Kriminalroman
Als Kommissar Bellinger von der Kripo Frankfurt zu einer Mordermittlung hinzugezogen wird, kann er seinen Augen kaum trauen. Das Mordopfer ist die Frau seines Freundes Daniel Rixen. Rixen ist Sektionsassistent und ein charismatischer Mann mit dunkler Vergangenheit. Alle Indizien deuten auf Rixen als Täter hin, doch Bellinger zweifelt nicht an dessen Unschuld. Lässt er sich von seinem Freund blenden? Weitere Morde an Frauen aus Rixens Vergangenheit geschehen und eine Postkarte mit einem Schopenhauer-Zitat macht die Ermittlungen komplizierter, als sie ohnehin schon sind.