Das Wissenschaftskolleg zu Berlin - Institute for Advanced Study, gegründet 1981 von Peter Glotz, gilt international als eines der erfolgreichsten Institute seiner Art. Anlässlich des 25-jährigen Bestehens im Herbst 2006 wird eine Rückschau geworfen. Renommierte deutsche und internationale Autoren, viele davon Fellows des Wissenschaftskollegs, schildern dessen Entwicklung und ihre Erfahrungen in verschiedenen Wissensfeldern. Sie reflektieren, was an diesen Erfahrungen exemplarisch und zukunftsweisend ist und welchen Beitrag das Wissenschaftskolleg zur Neuorientierung in einzelnen wissenschaftlichen Disziplinen geleistet hat. Das Buch bietet eine komprimierte Geschichte des Instituts und dokumentiert Fachgeschichten in nuce. Die Leser erfahren, welchen Einfluss einzelne Forscherpersönlichkeiten und die besondere Konstellation von Wissenschaftlern auf die Entstehung neuer Fragestellungen hatten. Zu den Autoren zählen unter anderem der Literaturwissenschaftler Wolfgang Frühwald sowie die ehemaligen Rektoren Peter Wapnewski, Wolf Lepenies und Dieter Grimm. Auch langjährige Weggefährten des Wissenschaftskollegs wie Horst Bredekamp, Lorraine Daston, Yehuda Elkana und viele andere kommen zu Wort.
Wolf-Dieter Grimm Livres
Dieter Grimm est un juriste allemand et ancien juge de la Cour suprême, auteur de plusieurs ouvrages relatifs au droit. Ses écrits plongent en profondeur dans les questions juridiques et leur impact sociétal. Grimm offre un regard pénétrant sur l'évolution de la pensée juridique et son application dans le monde moderne. Ses textes sont appréciés pour leur expertise et leur clarté.
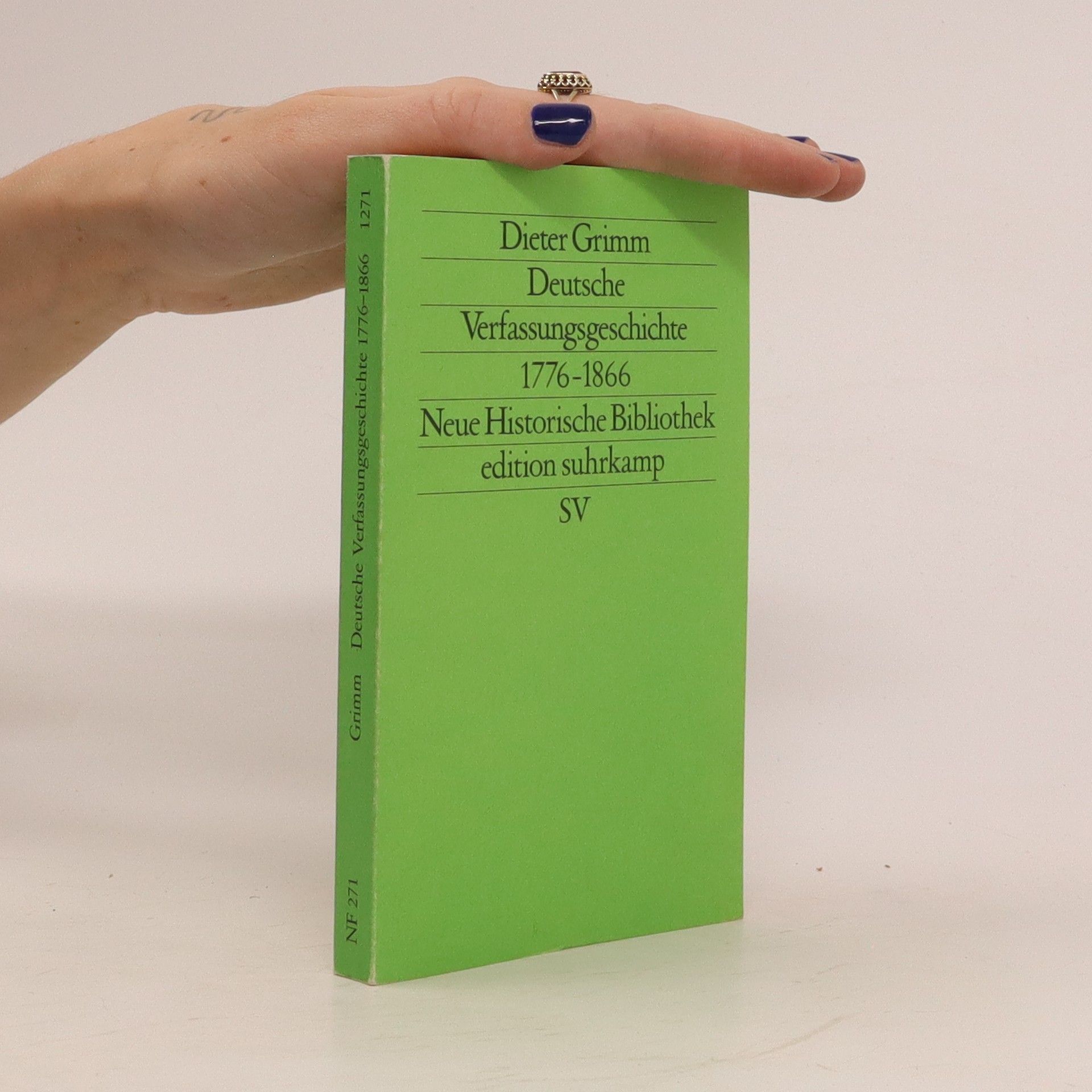
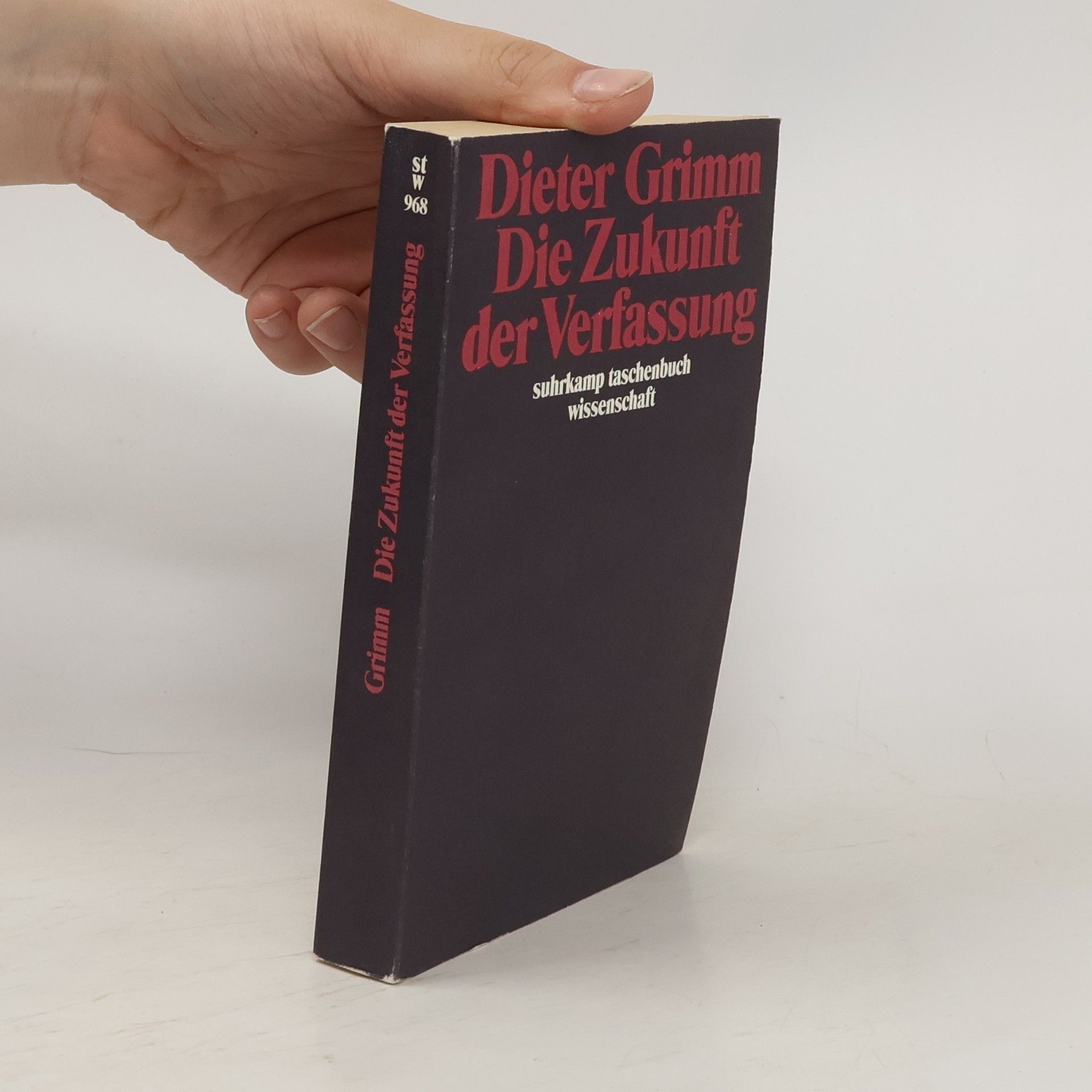


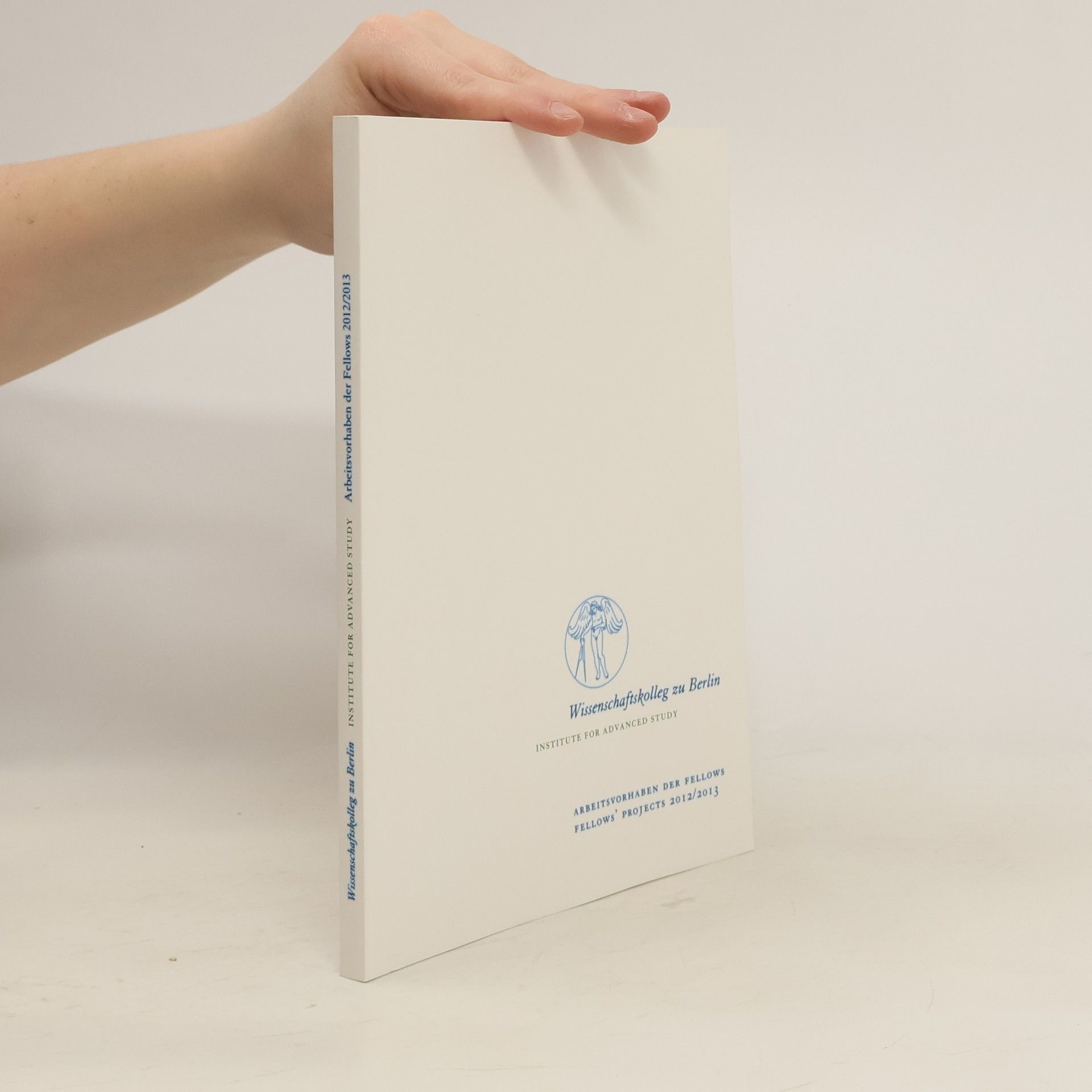

Recht oder Politik?
Die Kelsen-Schmitt-Kontroverse zur Verfassungsgerichtsbarkeit und die heutige Lage.
- 51pages
- 2 heures de lecture
Im Zentrum der Auseinandersetzung steht der Konflikt zwischen Hans Kelsen und Carl Schmitt über die Rolle von Verfassungsgerichten. Kelsen betrachtete diese als essenziellen Bestandteil einer Verfassung, während Schmitt eine alternative Auffassung vertrat und die Verfassungsgerichtsbarkeit ablehnte. Die Gründung zahlreicher Verfassungsgerichte in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts schien Kelsen zu bestätigen, doch im 21. Jahrhundert wächst die Kritik erneut, die das Spannungsfeld zwischen Recht und Politik beleuchtet. Die Schrift bietet eine tiefgehende Analyse dieser Thematik.
Europa ja - aber welches?
Zur Verfassung der europäischen Demokratie
Die Europäische Union hat keinen Mangel an Kritik und Akzeptanzproblemen – doch die Ursachen werden häufig an der falschen Stelle gesucht. Während viele hoffen, dass sich durch eine Ausweitung der Kompetenzen des Europäischen Parlaments das Demokratiedefizit der Union beheben lässt, zeigt Dieter Grimm, warum diese Hoffnung trügt. In grundsätzlichen Erörterungen und Einzelstudien zeigt Grimm, einer der renommiertesten deutschen Rechtswissenschaftler, dass eine Ursache für die starken Akzeptanzprobleme meist übersehen wird, nämlich die Verselbständigung der exekutiven und judikativen Organe der EU (Kommission und Europäischer Gerichtshof) von den demokratischen Prozessen in den Mitgliedstaaten und der EU selbst, die ihre Wurzel wiederum in der vom Gerichtshof vorgenommenen „Konstitutionalisierung der Verträge“ hat. Er geht den Ursachen für diese problematische Entwicklung nach und bietet Vorschläge zu ihrer Korrektur an.
Die Zukunft der Verfassung
- 447pages
- 16 heures de lecture
Die Verfassung hat sich im 20. Jahrhundert weltweit durchgesetzt. Die Zahl der Staaten, in denen heute noch ohne Verfassung regiert wird, ist verschwindend gering. Es mehren sich aber Anzeichen, die auf eine zunehmende innere Schwäche der Verfassung hindeuten und Zweifel an ihrer unverminderten Fähigkeit zur Politikregulierung wecken. Da es der Verfassung nicht mehr gelingt, alle Träger öffentlicher Gewalt in ihr Regelungswerk einzubeziehen, muß man damit rechnen, daß sie auch nicht mehr alle Bereiche der Staatstätigkeit erfassen wird. Ob ein verändertes Verfassungsverständnis diesen Geltungsschwund auffangen kann oder die Verfassung zu einer Teilordnung verkümmert, bleibt vorerst offen.
1806 löste sich die politische Form auf, die tausend Jahre lang das Zusammenleben der Deutschen geprägt hatte, das »Heilige Römische Reich Deutscher Nation«. Kurz zuvor war in Amerika und Frankreich eine neue Form der politischen Existenz eines Volkes entstanden: der moderne Verfassungsstaat. Seine Übernahme und Ausgestaltung bestimmte fortan auch die deutsche Geschichte. An Verfassungsrecht, Verfassungsinterpretation und Verfassungspraxis lassen sich die jeweiligen Gesellschaftszustände und Machtverhältnisse ablesen. Die wechselvolle Entwicklung wird hier in ihrem politischen, sozialen, ökonomischen und kulturellen Kontext dargestellt: Der erste Band behandelt Durchsetzung und Ausbreitung des Verfassungsstaats von den Anfängen bis zur Auflösung des Deutschen Bundes, der zweite Band Konsolidierung und Krise von der Reichsgründung bis zur Gegenwart.
Das neue nationale Kulturgutschutzgesetz ist umstritten. Untersucht wurde es bisher fast ausschließlich unter rechtlichen Gesichtspunkten. In diesem Buch arbeiten Kunsthistorikerinnen und Rechtswissenschaftler erstmals gemeinsam und auf der Grundlage von umfangreichen Archivstudien die folgenreichen Anfänge des Abwanderungsschutzes auf und evaluieren den Nationsbegriff des Gesetzes und die impliziten Bewertungskriterien für "national wertvolles Kulturgut" in der Praxis. Sie identifizieren dabei wiederkehrende Konflikte und entwickeln Vorschläge für Vollzug und Reform des Gesetzes.
Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts. Studienauswahl. Studienauswahl
- 879pages
- 31 heures de lecture
Eine wertvolle Sammlung, die sich unbedingt zulegen lässt und den Preis wert ist!
Lektüre und Geltung
Zur Verstehenspraxis in der Rechtswissenschaft und in der Literaturwissenschaft
Grundrechtsfunktionen jenseits des Staates
- 122pages
- 5 heures de lecture
Wie entwickelt sich das Recht in Zukunft? Welches Recht findet der Jurist in der Zukunft vor? Welche Regelungsaufgaben sind absehbar und welche rechtlichen und methodischen Innovationen wurden sie verlangen? Wie keine andere rechtliche Institution ermoglichen Grundrechte normative Lernprozesse. Die Aufsatze von Dieter Grimm (Hauptreferat) und Anne Peters (Kommentar) blicken deswegen auf die Errungenschaften von Grundrechten und auf ihre Zukunft jenseits des Staates.