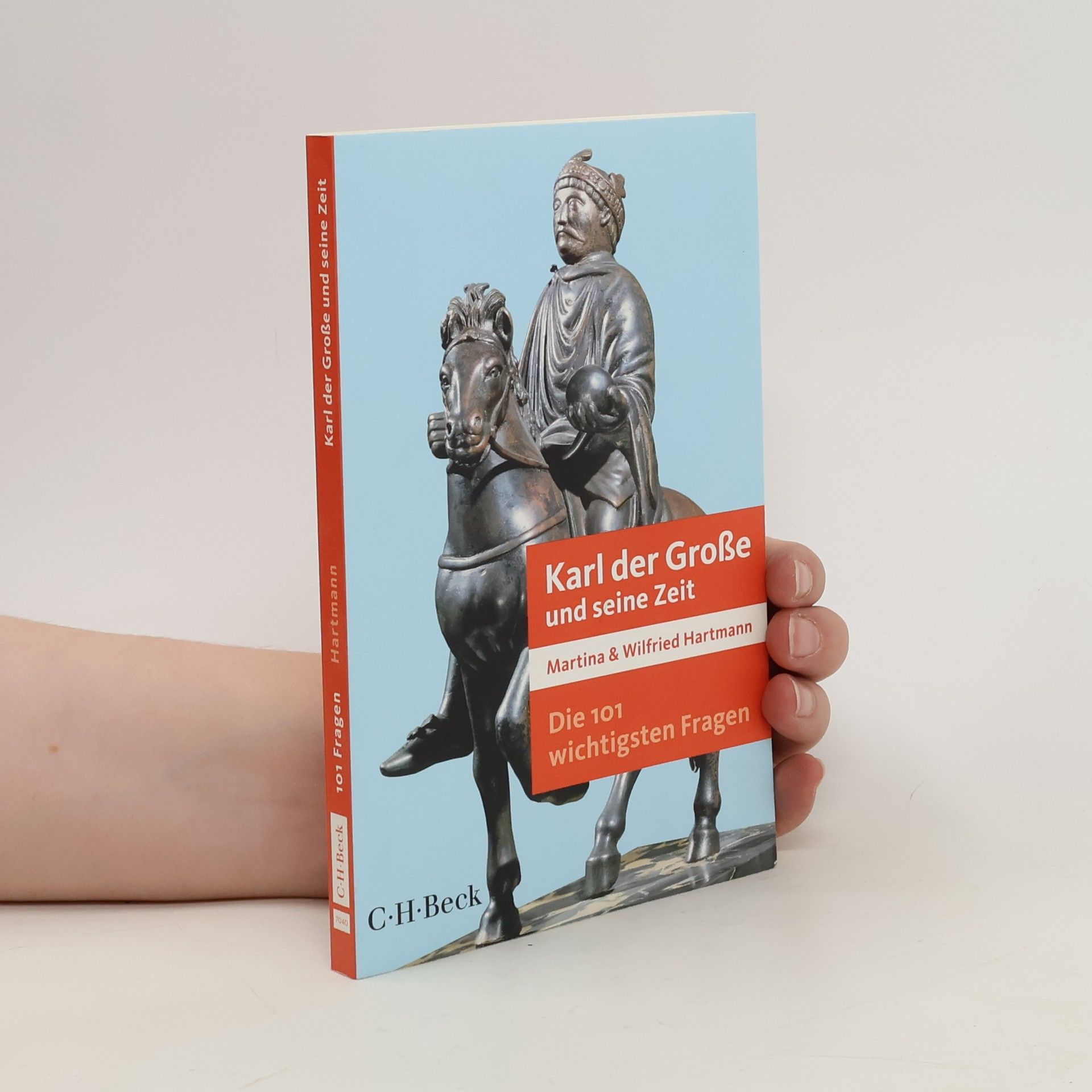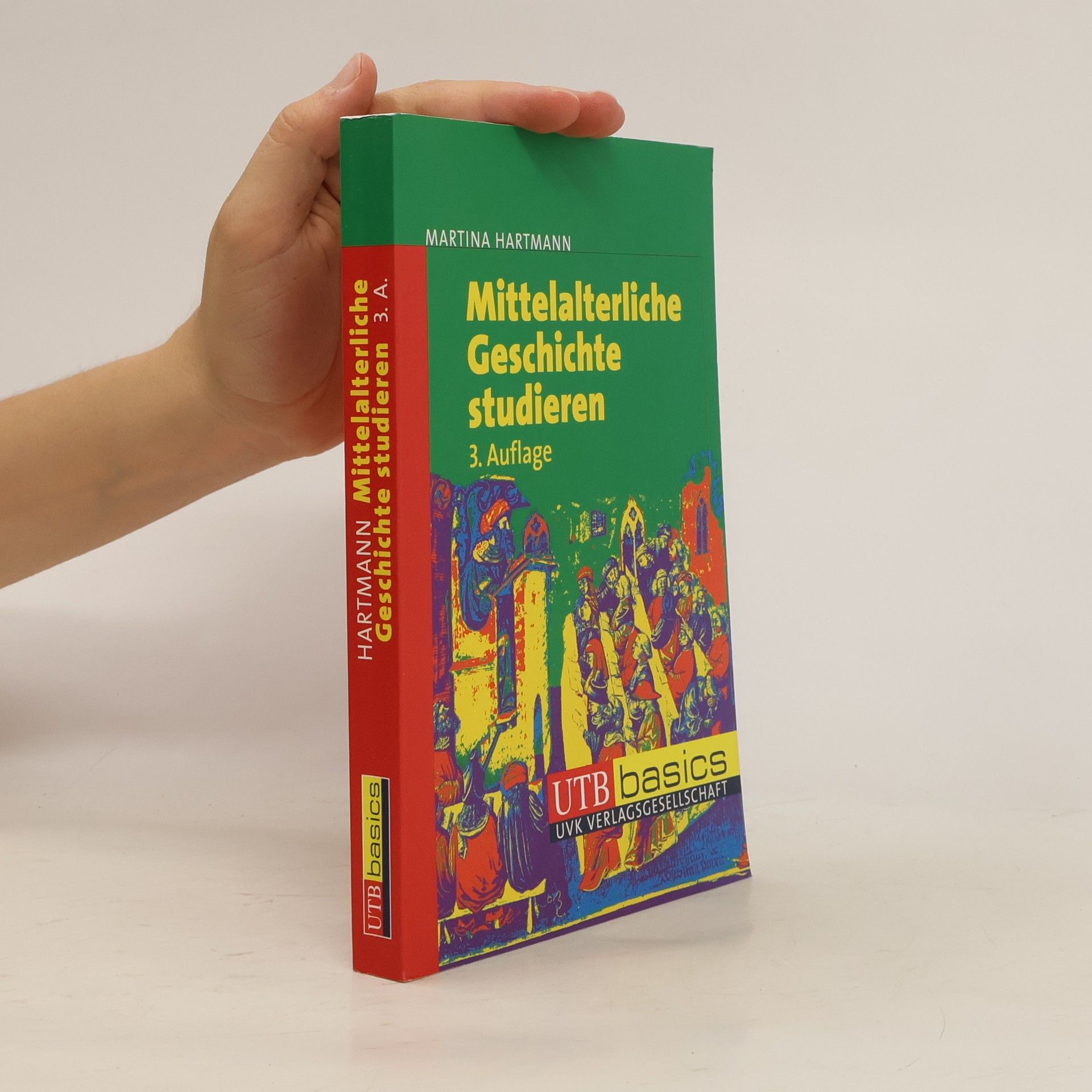Aufbruch ins Mittelalter
Die Zeit der Merowinger
Die Gründung des Fränkischen Reichs durch die Merowinger war die bedeutendste germanische Reichsgründung der Völkerwanderungszeit, denn im Fränkischen Reich wurden die entscheidenden Grundlagen für die Entwicklung Westeuropas gelegt. Die vorliegende Gesamtdarstellung der Geschichte der Merowingerzeit vermittelt nicht nur einen ausgezeichneten Überblick über die politischen Prozesse in diesen fast 300 Jahren, sondern sie nimmt ebenso ausführlich den Alltag (z. B. Ernährung, Wohnen, Kleidung, Körperpflege, Medizin, Zeitvertreib), Bildung und Kultur (z. B. Bildungszentren, Schriftlichkeit), die Kirche (z. B. Mission, Bistumsorganisation, Klöster, religiöses Leben), Wirtschaft (z. B. Ackerbau, Handel und Verkehr) und das Rechtswesen (z. B. Hof, Beamtenschaft, Fehdewesen, Gerichte) in den Blick. Die durchgängige Quellennähe – manche der zitierten Quellen sind hier erstmals ins Deutsche übersetzt – sowie zahlreiche Illustrationen der wichtigsten kunsthandwerklichen Hinterlassenschaften und berühmter archäologischer Funde tragen zu einem vertieften Verständnis der Menschen in der damaligen Zeit bei.