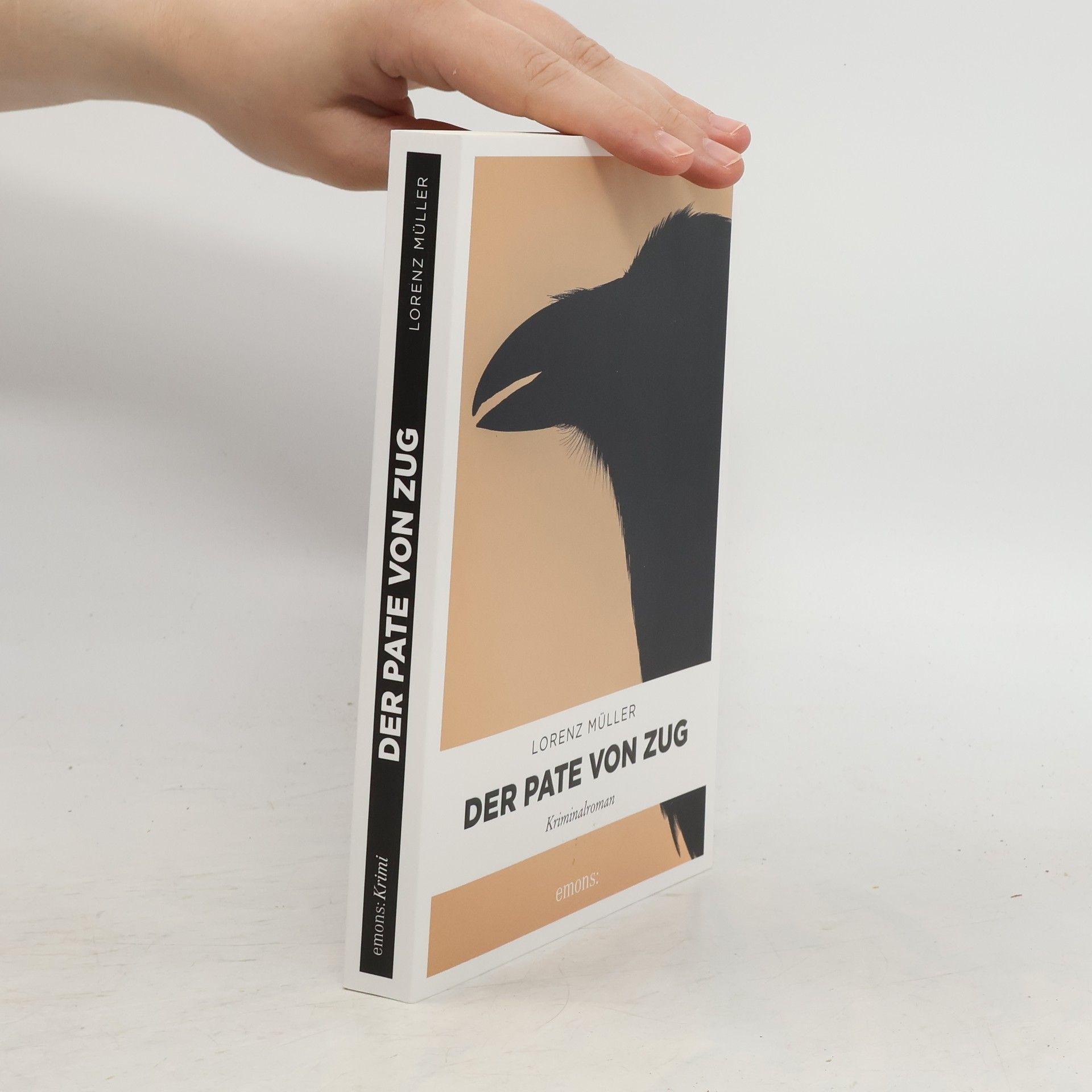Der Pate von Zug
Kriminalroman
Mafiosi, Morde und Moneten. Eigentlich wollte Daniel Garvey den Sommer genießen. Doch ein brutaler Mord an einem hochrangigen Ex-Militär und das spurlose Verschwinden seiner Freundin Anna zwingen ihn dazu, sich mit einem kompromisslosen Gegner anzulegen: dem Organisierten Verbrechen. Waffendeals, Geldwäsche und sonstige schmutzige Geschäfte – Garvey ist mittendrin. Als ob das nicht genug wäre, holt ihn auch noch ein Schatten aus seiner Vergangenheit ein, den er lieber unter einem schweren Stein begraben wüsste . . .