Karl-Heinz Voigt Livres

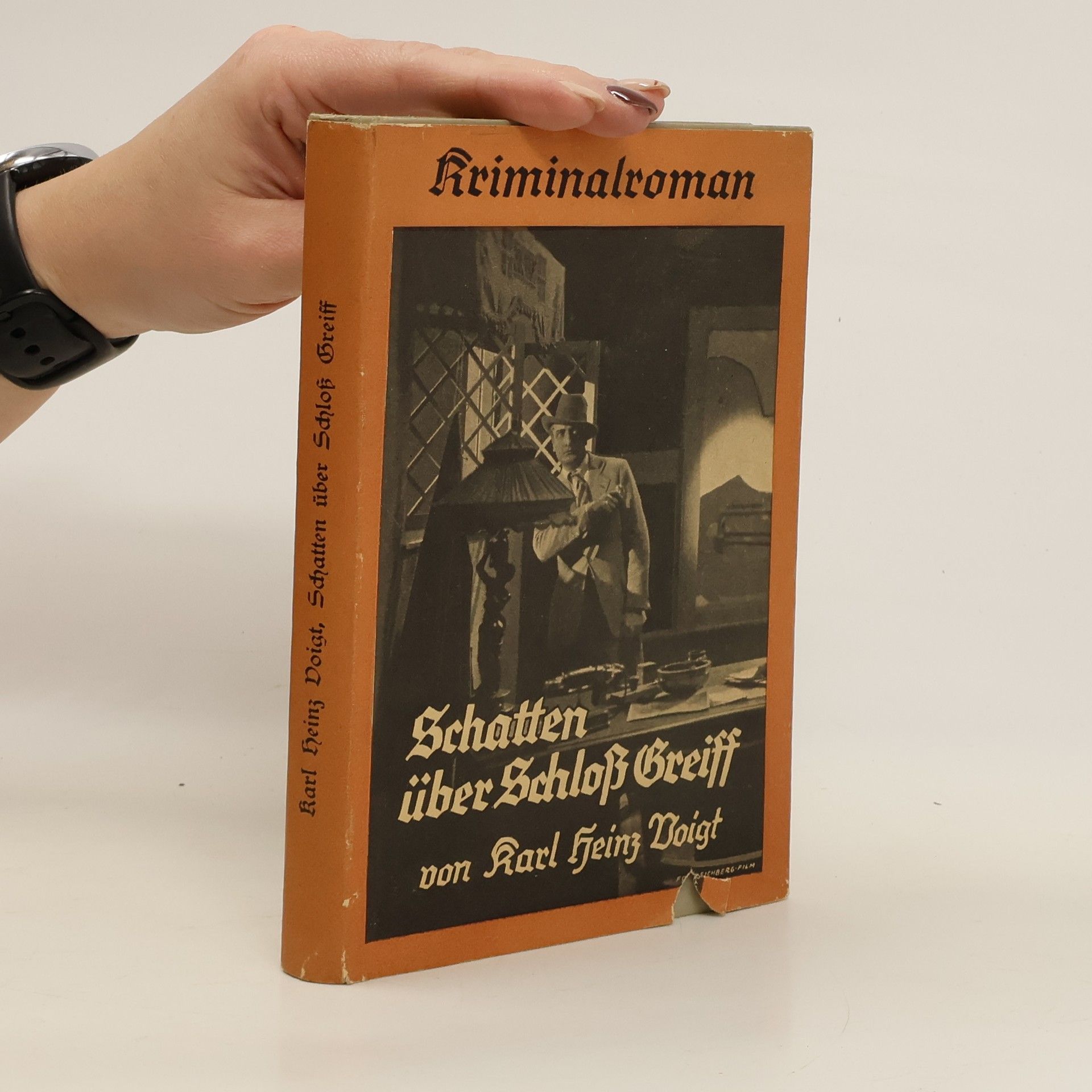
Der Band schließt eine empfindliche Lücke in der Darstellung protestantischer Kirchengeschichte in Deutschland. Durch die Ökumenische Bewegung ist eine Neubewertung der Freikirchen eingeleitet worden. Sie hat bisher allerdings mehr bei Ökumenikern, Kirchenleitungen und ökumenisch engagierten Gemeindegliedern als im Bereich der wissenschaftlichen Forschung Beachtung gefunden. Eine Aufarbeitung und ökumenische Interpretation der Geschichte von Minderheitenkirchen in Deutschland wird hier unter Berücksichtigung ihrer Geschichte, ihrer unterschiedlichen theologischen Akzente, ihrer jeweiligen Struktur und ihrer typischen Frömmigkeitsmerkmale kenntnisreich entfaltet. Dabei werden die Unterschiede der Freikirchen herausgearbeitet, gleichzeitig wird die Bedeutung gemeinsamer Minderheitenerfahrungen erörtert. Die in der wechselvollen deutschen Geschichte der letzten zweihundert Jahre unterschiedlichen Beziehungen zu Staat und Landeskirchen werden kritisch bedacht. Das Buch ist die erste Geschichte der Freikirchen, die in Deutschland erscheint.