Jürgen Heise Livres




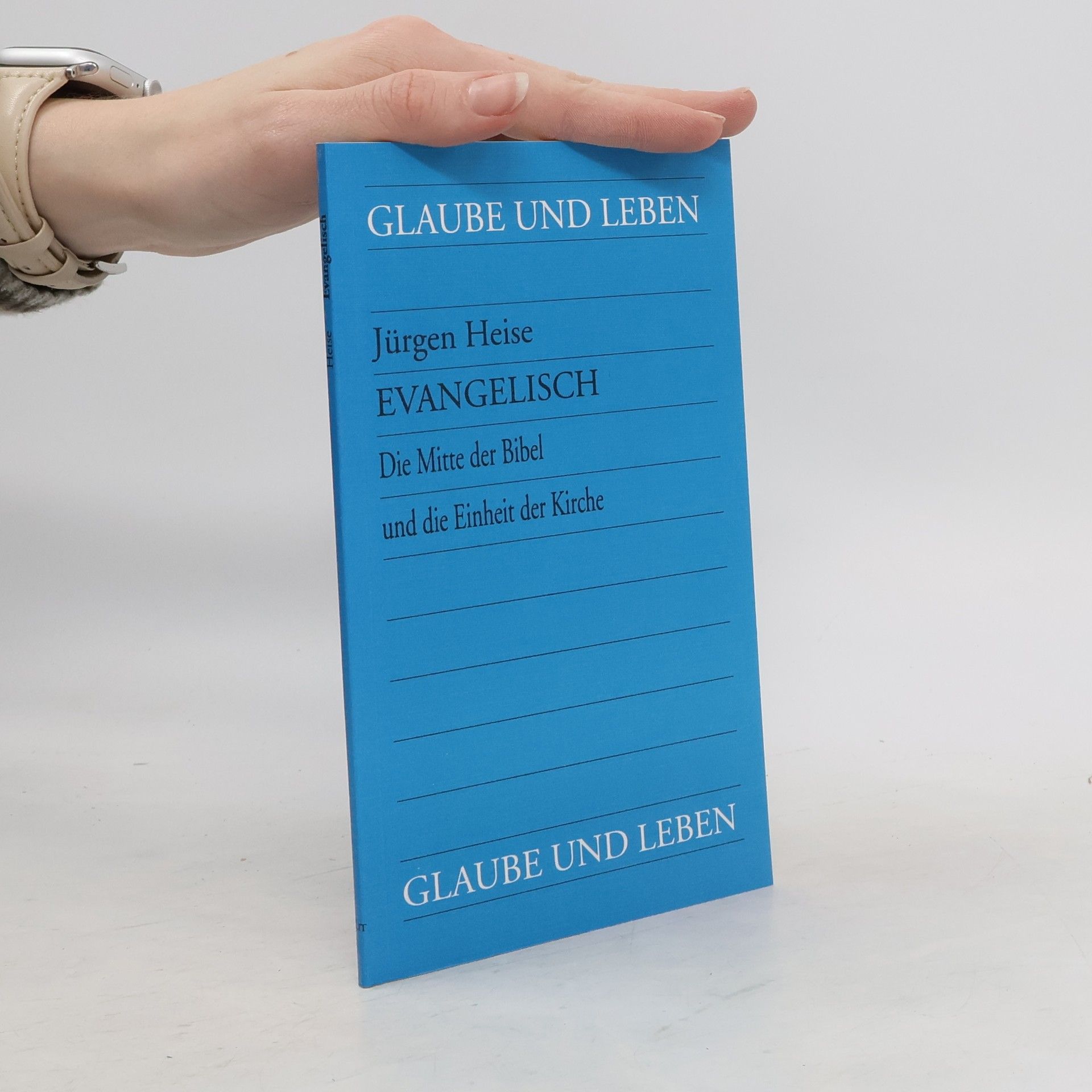

Evangelisch
- 47pages
- 2 heures de lecture
Heise analysiert in seinen Kunstessays die Strukturen der hispanischen Geisteswelt und porträtiert deren bedeutende Figuren. Er schafft ein Netzwerk von Beziehungen und nimmt die Leser mit auf seine hispanischen Exkursionen. Sein intensives Verhältnis zur iberischen Welt zeigt sich in seiner Lyrik und in Essays, die häufig Spanien und Spanisch-Amerika thematisieren. Obwohl er sich als Aficionado versteht, gilt er als profunder Kenner der spanischsprachigen Literatur. In seinen Essays zieht Heise das Fazit seiner Auseinandersetzungen mit dem Hispanischen auf beiden Seiten des Atlantiks. Einzeldarstellungen wichtiger Schlüsselfiguren werden durch Essays ergänzt, die historische, völkerkundliche und kulturmorphologische Zusammenhänge beleuchten. Heises Buch veranschaulicht den Aufstieg und Fall des „Ewigen Spanien“, das mit seiner nautischen Großtat das Zeitalter der Globalisierung einleitete. Themen umfassen die Erotik des Todes in Spanien, Federico García Lorca, Picasso und Dalí, Luis Buñuel, Rubén Darío, Jorge Luis Borges, Augusto Roa Bastos, Gabriel García Márquez, Pablo Neruda und Octavio Paz.
»Am Mischpult der Sinne« ist das Logbuch eines Lyrikers, der meint: »Auch Träume haben etwas Aufklärerisches, das die Aufklärung subversiv hinterfragt.« »Er verwendet Grazie auf seine Darstellung, etwas bei uns immer seltener Werdendes«, so Karl Krolow über Hans-Jürgen Heise. Der hat sein schriftstellerisches Schaffen schon früh reflektierend begleitet. In einem Zeitraum von mehr als 30 Jahren sind diese Essays entstanden, die Heise zu dem Band »Am Mischpult der Sinne« zusammengestellt hat. Die Arbeiten bilden gewissermaßen seine poetologische Autobiographie und damit das Gegenstück zu »Die Zeit kriegt Zifferblatt und Zeiger«, der faktischen Autobiographie. Einzelstücke und Zyklen durchdringen einander stichwortgebend. Essays zur Metapher, zum freien Vers, aber auch zu Heises Selbstverständnis als Lyriker stehen neben Darstellungen der spanischen, lateinamerikanischen und US-amerikanischen Dichtung. Weitere Themenschwerpunkte bilden Betrachtungen zum Transzendenzzerfall und zur Kunst im technischen Zeitalter. Abgerundet wird das Ganze durch persönliche Standortbestimmungen, Reden und Interviews, in denen Heise Einblicke in seine Werkstatt und seine Motivwelt gibt.
Das Profil unter der Maske
- 253pages
- 9 heures de lecture



