Franz J. Weißenböck Livres
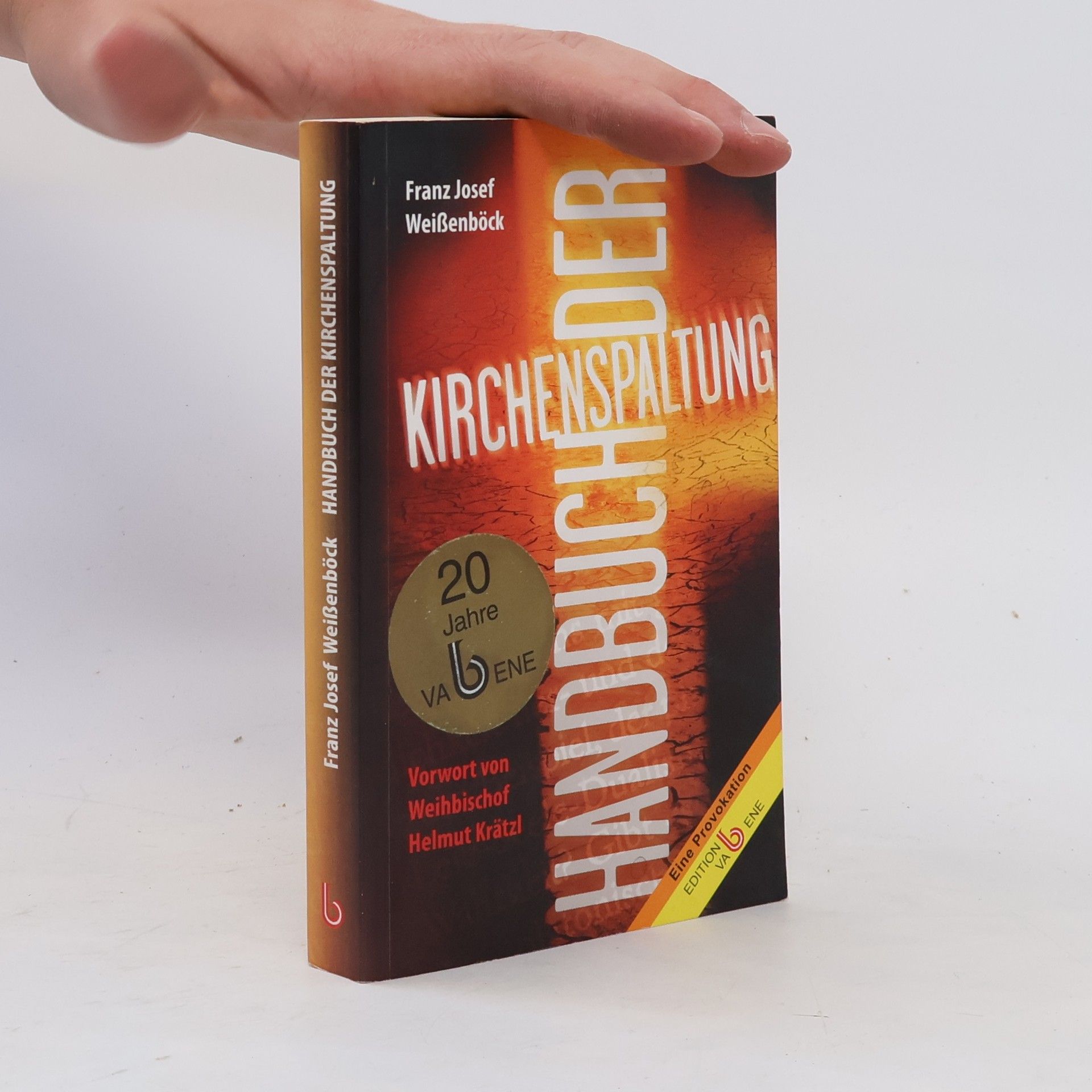
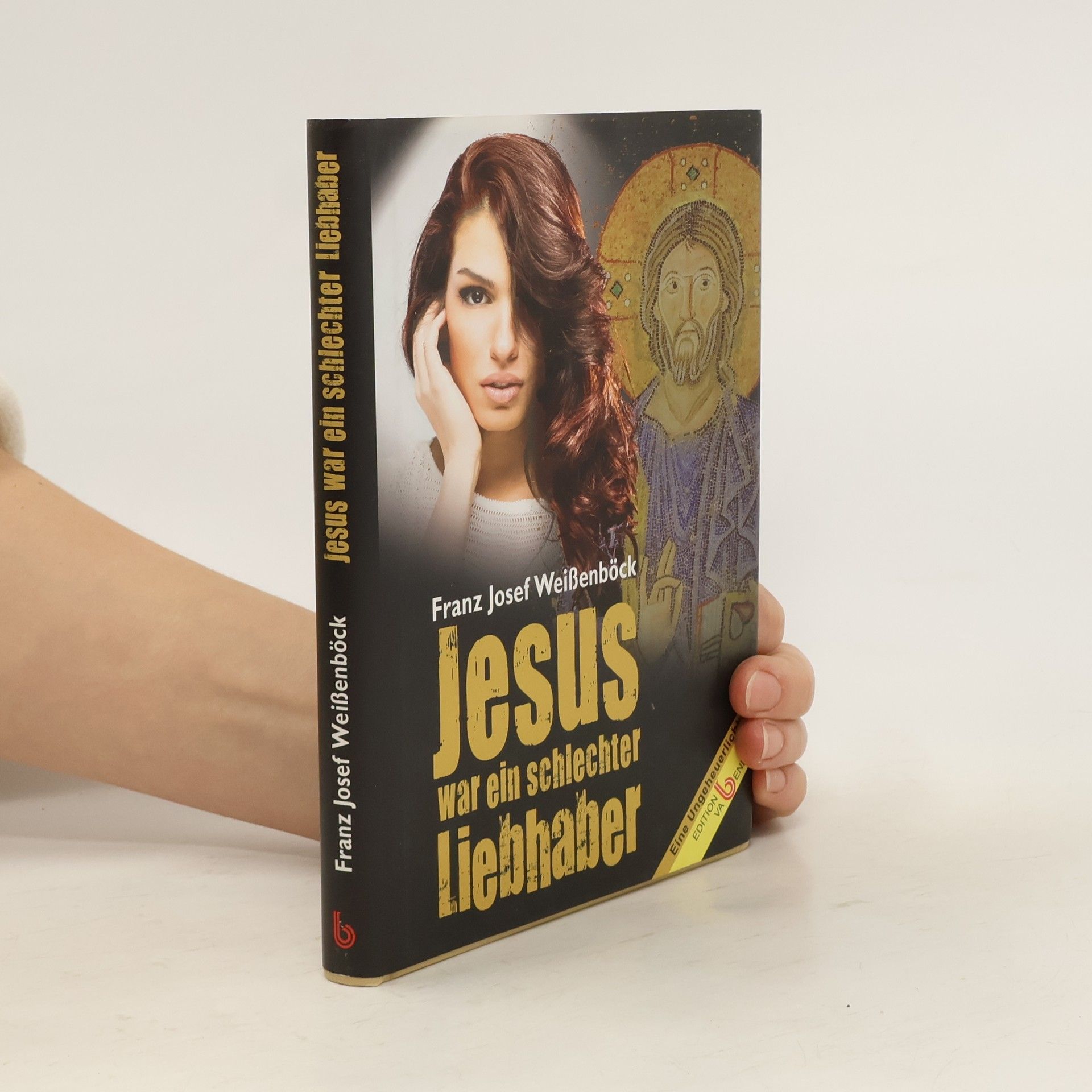

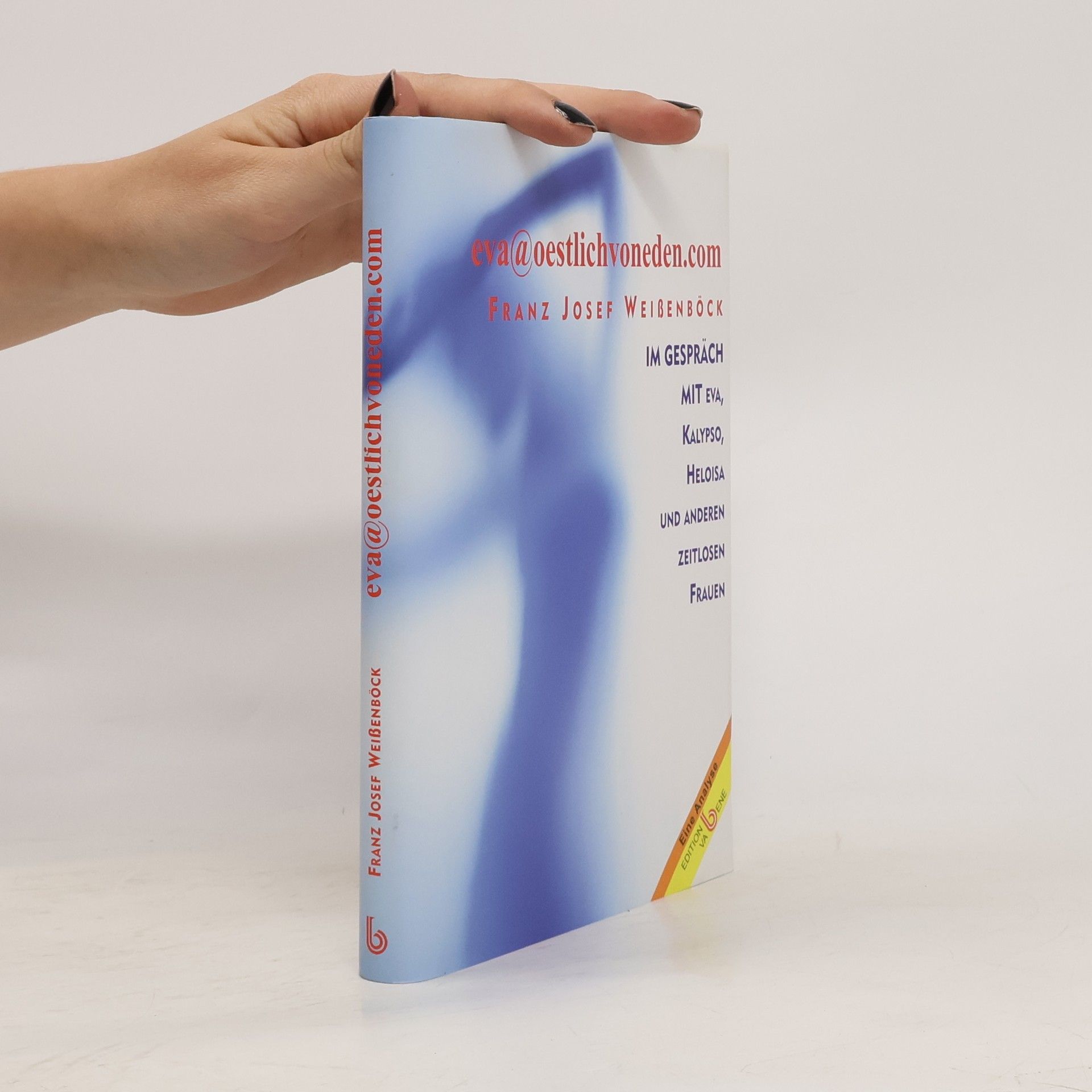
Ein Handbuch beschreibt Methoden, Verhaltensregeln und Vorgehensweisen zur Erreichung eines bestimmten Ziels. Ein „Handbuch für Kirchenspalter“ würde demnach solche Mittel darstellen, die der Kirchenspaltung förderlich sind. Der Inhalt dieses Buchs beleuchtet genau dies, ohne jedoch zu unterstellen, dass jemand die Kirche spalten möchte. Vielmehr wurden viele kritisierte Maßnahmen mit dem Ziel eingeführt, die Kirche zu einen. Dennoch entfalten die „Worte und Werke“ maßgeblicher kirchlicher Männer eine spaltende Wirkung, nicht in Form einer Abspaltung, sondern durch einen zunehmenden Graben zwischen dem Papst, den meisten Bischöfen und einigen Pfarrern auf der einen Seite und dem Kirchenvolk sowie vielen Pfarrern und einigen Bischöfen auf der anderen. Dies ist eine Folge der Tatsache, dass sich führende Kirchenvertreter, beginnend bei Papst Benedikt XVI., immer weiter vom Zweiten Vatikanischen Konzil entfernen. Die internationale Reaktion auf die Aufhebung der Kommunikation mit den vier Pius-Bischöfen und die massive Kritik an der Ernennung Gerhard Maria Wagners zum Weihbischof von Linz zeigen, dass viele Gläubige und Bischöfe diesen Weg als Irrweg erachten. Die Richtung, in die sich die Kirche bewegt, ist nicht nur für ihre Mitglieder und Funktionäre von Bedeutung, sondern betrifft die gesamte Gesellschaft.