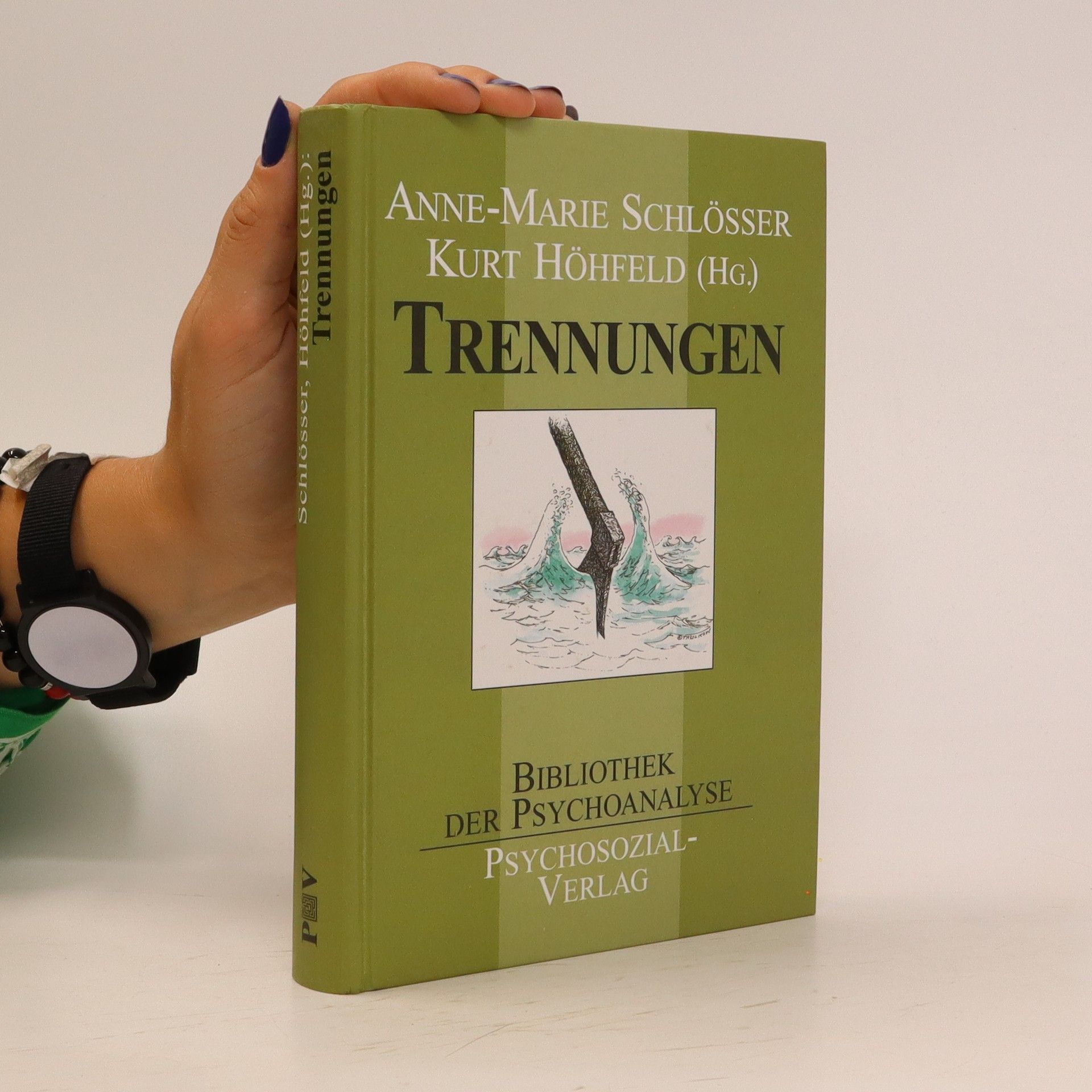Gewalt und Zivilisation
Erklärungsversuche und Deutungen. Eine Publikation der DGPT
- 688pages
- 25 heures de lecture
Im öffentlichen Diskurs wird ununterbrochen von Gewalt gesprochen, die als Einbruch in eine friedlich-normale Welt erscheint und zugleich fasziniert sowie unerklärlich bleibt. Die Terroranschläge am 11. September 2001 haben das Thema verstärkt in den Fokus gerückt. Psychoanalytiker betonen die menschliche Aggressivität und machen deutlich, dass Gewalt ein konstitutiver Bestandteil der Zivilisation ist. Der kulturell erzwungene Verzicht auf „Inzest, Kannibalismus und Mordlust“, wie Freud 1927 formulierte, sichert Zivilisation, führt jedoch auch zu einer unbewussten Rebellion gegen die Unterdrückung dieser Triebwünsche. Gewalt ist demnach nicht nur ein äußeres Phänomen, sondern könnte ein interner, unverzichtbarer Teil unserer fortschrittlich orientierten Zivilisation sein. Es wird zunehmend schwierig, zwischen einem Fortschritt, der das Leben erleichtern könnte, und dessen destruktiven Folgekosten zu unterscheiden. Die Eskalation rechtsradikaler Gewalt wirft Fragen zur Zivilisation auf, die dieses Potenzial hervorbringt. Unter dem Stichwort „Kultur, Kunst, Sublimierung“ finden sich Beiträge zur künstlerischen Verarbeitung von Gewaltphänomenen. Zudem wird der Berufsstand der Psychoanalytiker betrachtet, insbesondere in Bezug auf offene oder verborgene Manifestationen von Destruktivität in der Behandlungssituation und Ausbildung.