Im Juni 1909 wurde die erste Auflage der Baukonstruktionslehre von Frick und Knöll veröffentlicht, die als Leitfaden für den Unterricht an den Königlich Preußischen Baugewerkschulen diente. Im Laufe der Jahre entwickelte sich das Werk zu einem Standardwerk für Architekten und Ingenieure, bestehend aus zwei Teilen. Mit der 27. Auflage von Teil 1 und der 26. Auflage von Teil 2 haben die aktuellen Verfasser die Bearbeitung übernommen. Der "Frick-Knöll" bleibt die am weitesten verbreitete Baukonstruktionslehre für Studierende und ein geschätztes Nachschlagewerk für Fachleute. Es wird erwartet, dass eine Baukonstruktionslehre die wesentlichen Aufgaben des Bauens abdeckt und verschiedene Konstruktionsprinzipien in Rohbau, Innenausbau und teilweise Technischen Ausbau berücksichtigt. Zudem muss sie die sich ständig weiterentwickelnden Herstellungsverfahren darstellen. Alle Baukonstruktionen sind von statischen Bedingungen, bauphysikalischen Einflüssen, Baustoffeigenschaften, Baukosten, Bauabwicklung sowie behördlichen Bestimmungen und Normen abhängig. In der aktuellen Überarbeitung wurden Ergänzungen vorgenommen, um den bautechnischen Entwicklungen und der fortlaufenden Normierung Rechnung zu tragen. Der wachsende Umfang des benötigten Grundlagenwissens erforderte eine angepasste Stoffverteilung.
Neumann Livres
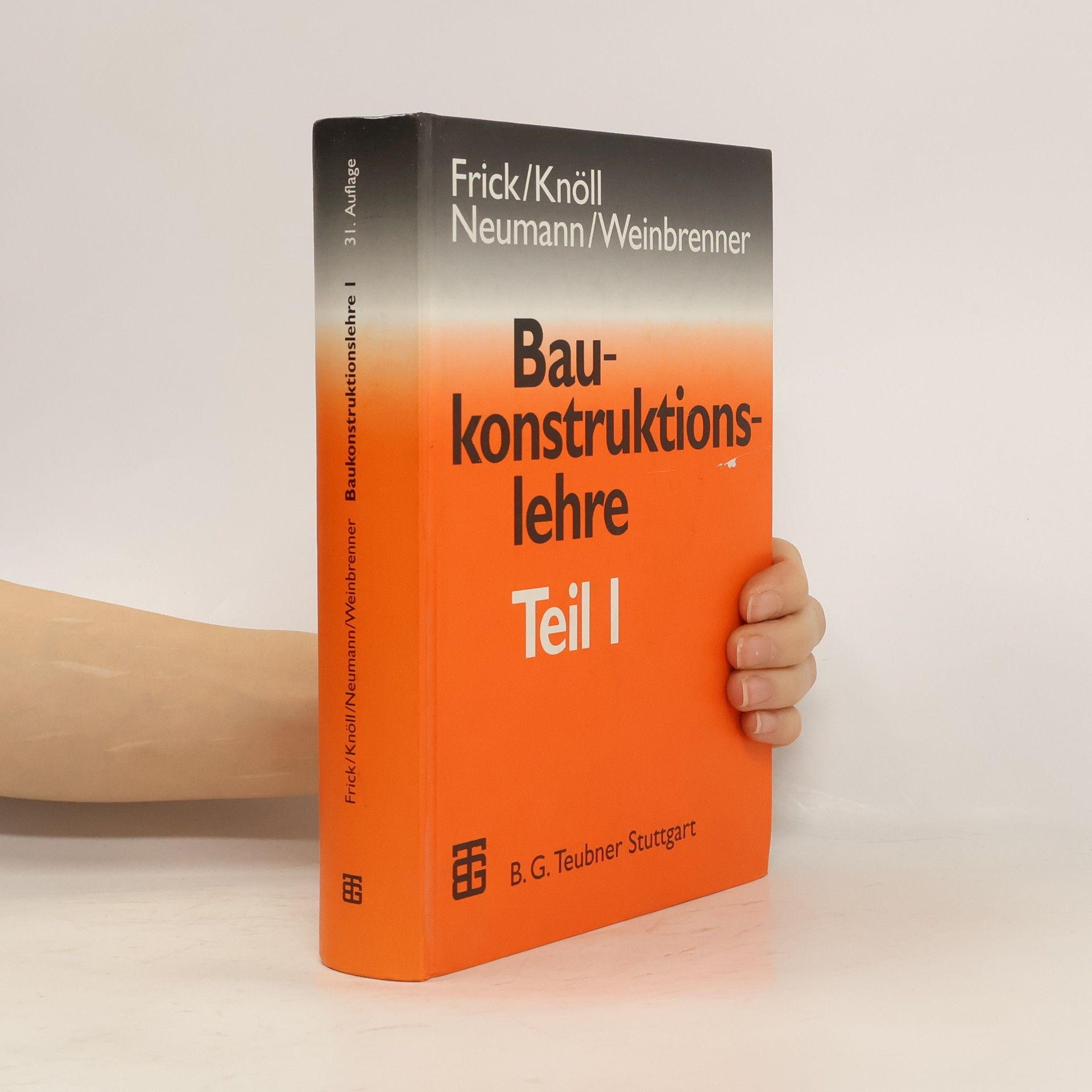


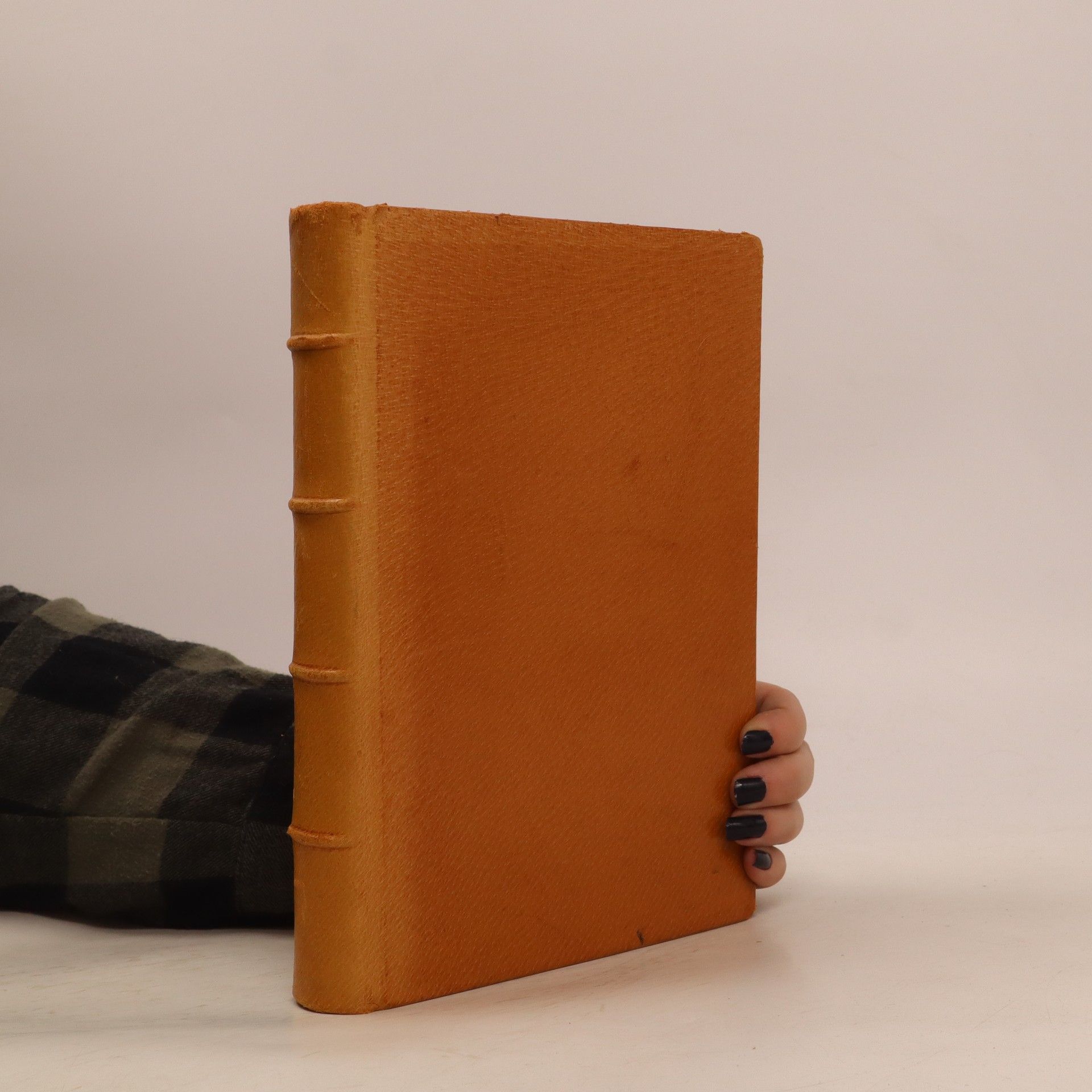
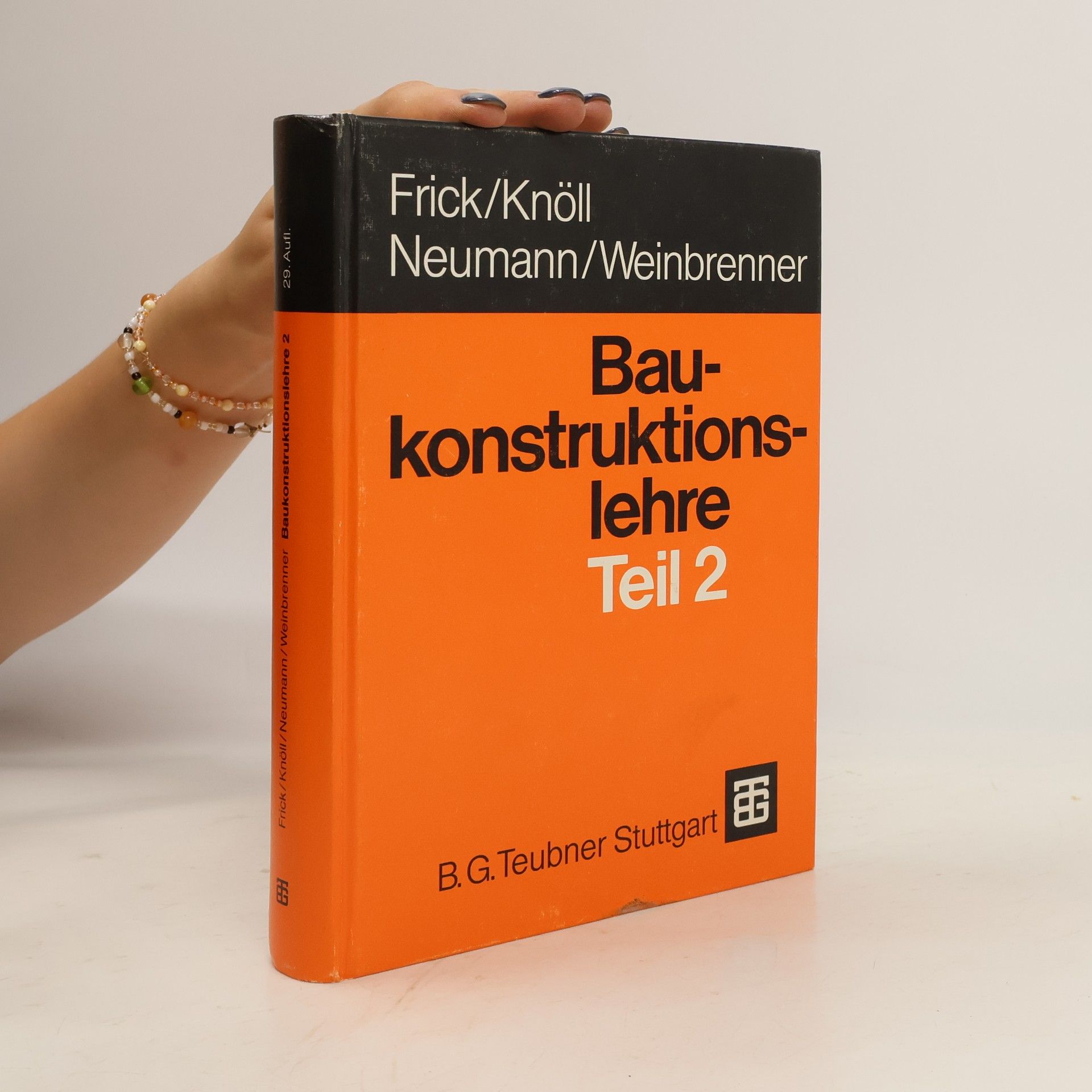
Kiesstrasse, zwanzig Uhr
Huss'sche Universitätsbuchhandlung, 1983-1993. Eine Anthologie
- 321pages
- 12 heures de lecture
German, English, Italian
Baukonstruktionslehre 1
31. Auflage