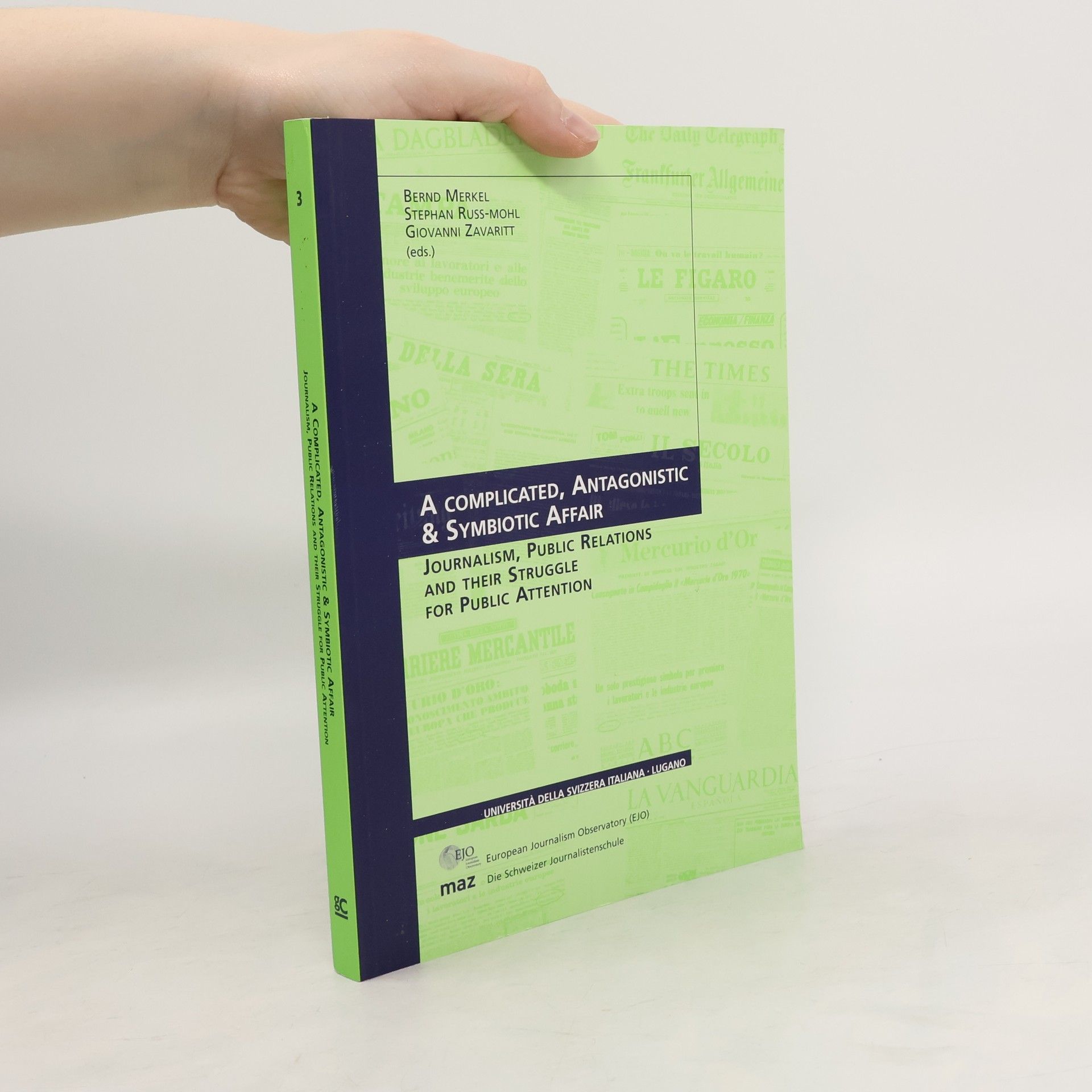Zerreißproben
Leitmedien, Liberalismus und Liberalität
Erleben Liberalismus und Liberalität im 21. Jahrhundert eine neue Blüte? Oder durchleben sie eine tiefe Krise? Viele liberale Werte treffen heute auf breite Zustimmung, doch manche werden vehement bekämpft. Der öffentliche Diskurs scheint bunter denn je, gleichzeitig greifen Intoleranz und Diskursverweigerung um sich. Meinungsumfragen zeigen große Unterstützung für gesellschaftsliberale Politiken, der Wirtschaftsliberalismus bleibt dagegen ein weithin liebevoll gepflegtes Feindbild.Wie steht es also um Liberalismus und Liberalität im öffentlichen Diskurs? Sie stehen unter Druck - und sind Zerreißproben unterworfen: Neoliberalismus, Identitätspolitik, Corona-Krise. Im Mittelpunkt dieser Zerreißproben stehen immer wieder Medien und Journalismus.Was wissen wir über das Verhältnis von Leitmedien zu Liberalismus und Liberalität? Wie wird über liberale Anliegen oder Parteien berichtet? Wie sehen und empfinden Journalisten ihr Verhältnis zum Liberalismus - und die Liberalität des Berufsfelds? Kann und sollte der Journalismus für mehr Freiheit Partei ergreifen? Und warum hat der "Neoliberalismus" einen so schweren Stand in Redaktionsstuben? Wie ergeht es in diesem medialen Umfeld liberalen Parteien, aber auch der innerparteilichen Streitkultur?Die Autorinnen und Autoren dieses Bandes erkunden Antworten auf diese Fragen