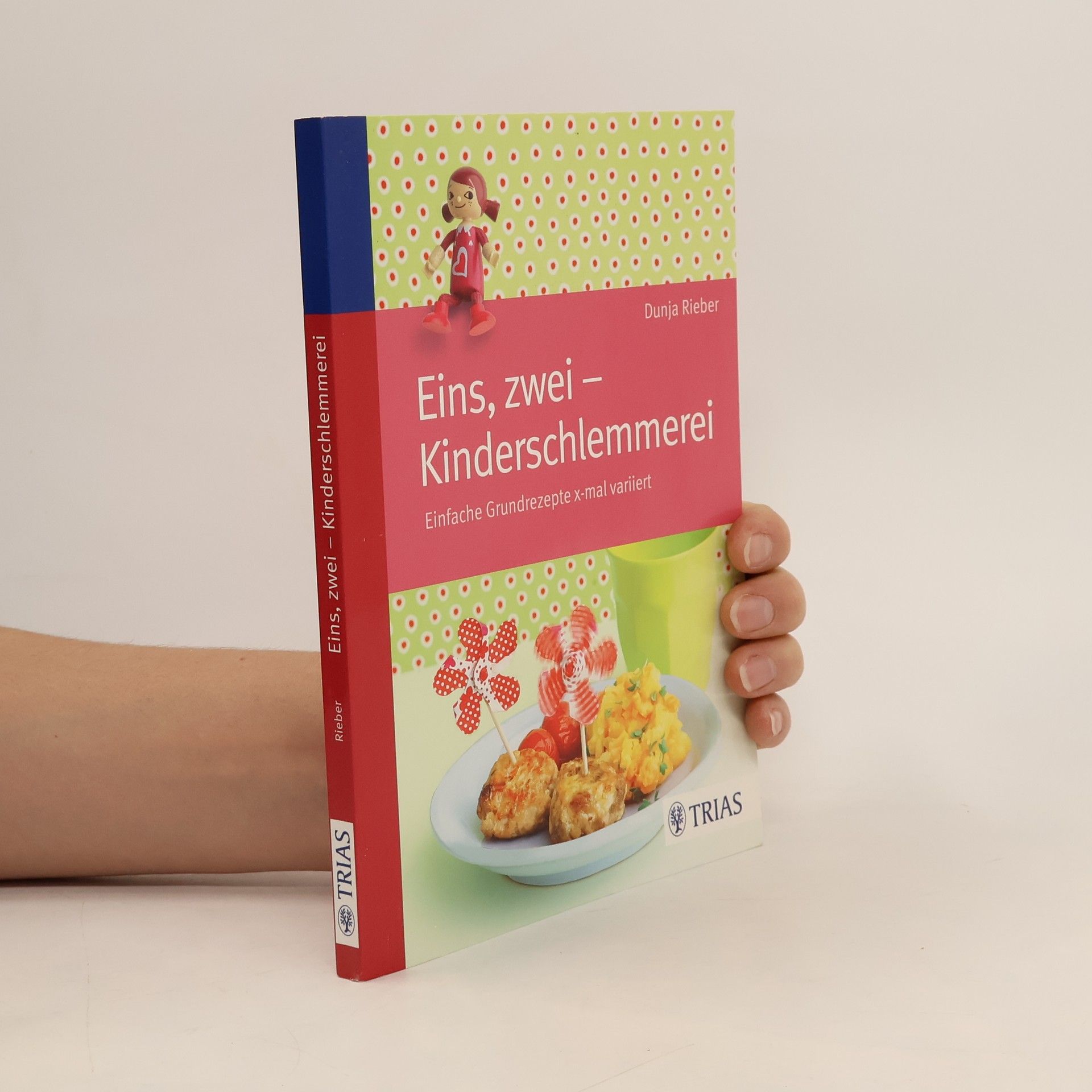Medienvermittelte Kommunikation ist ein wesentlicher Bestandteil des Lebens geworden, und die Furcht vor der Allmacht neuer Medien ist oft unbegründet. Dennoch verändern sich mit neuen Vermittlungstechniken die Mediengewohnheiten. Die Forschung legt zunehmend Wert auf die Funktionalitäten verschiedener Medien und die biografische Differenzierung. Die zentrale Frage ist, ob die Technische Dokumentation diesen Veränderungen gerecht wird und ob ihre Kommunikationsangebote situations-, zielgruppen- und medienadäquat sowie rechtssicher sind. In zwölf Beiträgen erörtern Fachleute aus verschiedenen Disziplinen diese Fragen. Die Themen reichen von Forschungsübersichten und theoretischen Erklärungsmodellen bis zu Kosten-Nutzen-Rechnungen und der Beschreibung einer kollaborativen Plattform zur Produktinformation. Die Inhalte umfassen: - Veränderungen der Mediennutzung - Zielgruppendifferenzierung in den Sozialwissenschaften und deren Implikationen für die Technische Dokumentation - Historische Entwicklung neuer Medientechniken - Eignung verschiedener Medien für unterschiedliche Produkte - Auswirkungen neuer Medientechniken auf Gesetzgebung und Rechtspflege - Normen und Medien - Sprachveränderungen durch neue Vermittlungstechniken - Selbsterklärende Geräte - Technische Dokumentation für E-Book-Lesegeräte - Web 2.0 in der TR-Ausbildung - Wirtschaftlichkeit verschiedener Medien für Technische Dokumentation - Kollaborative Medien in der
Marita Tjarks-Sobhani Livres