Felix Dirsch Livres
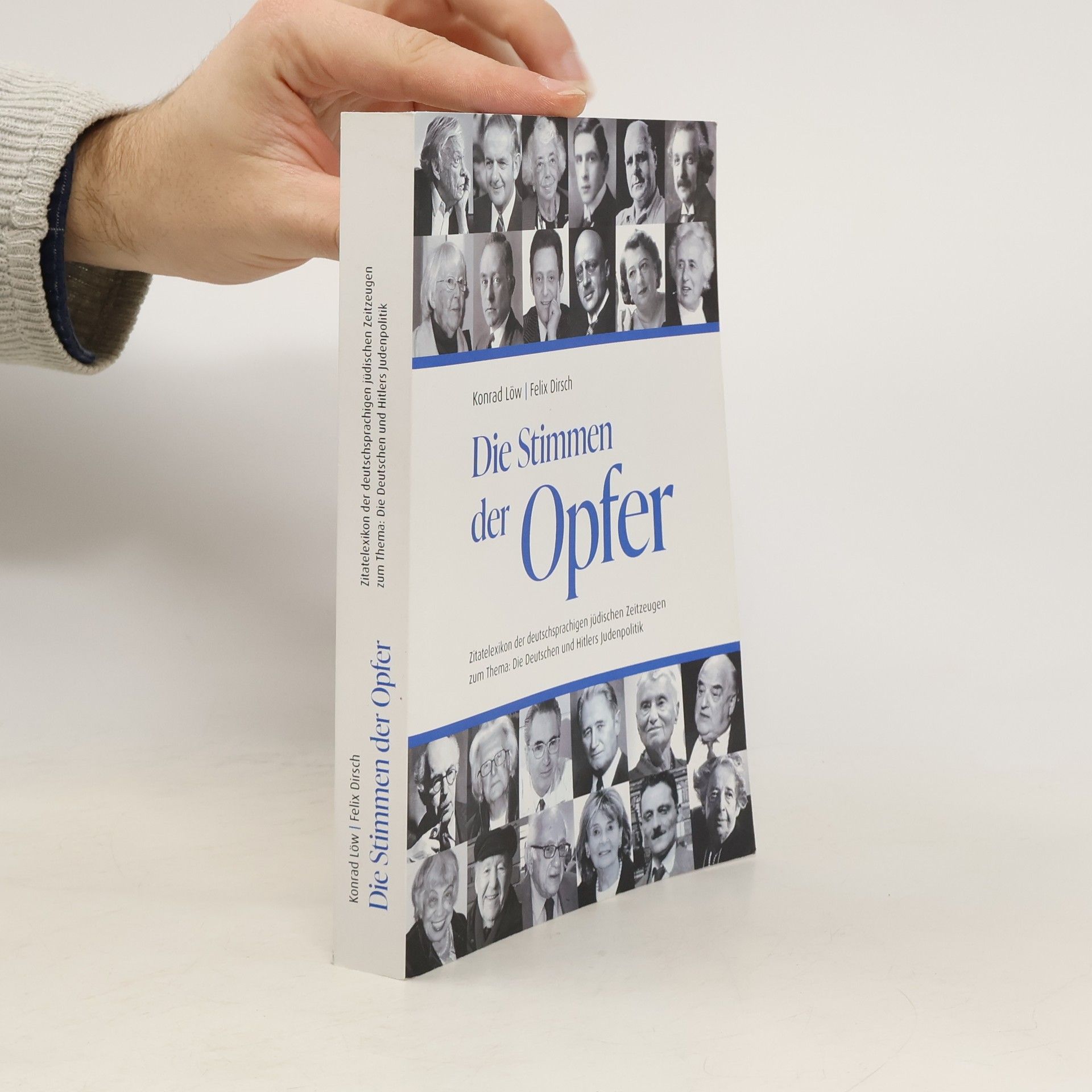
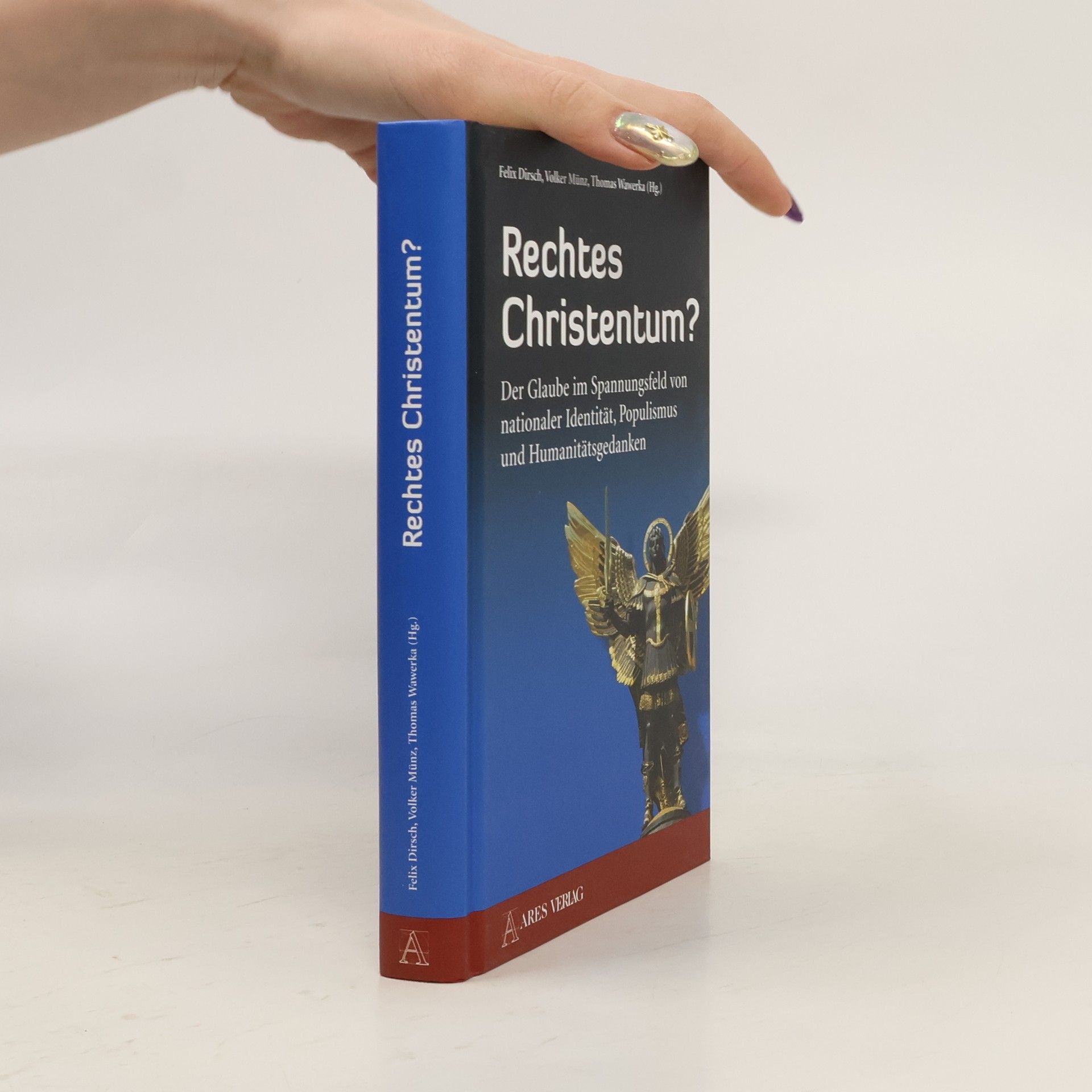
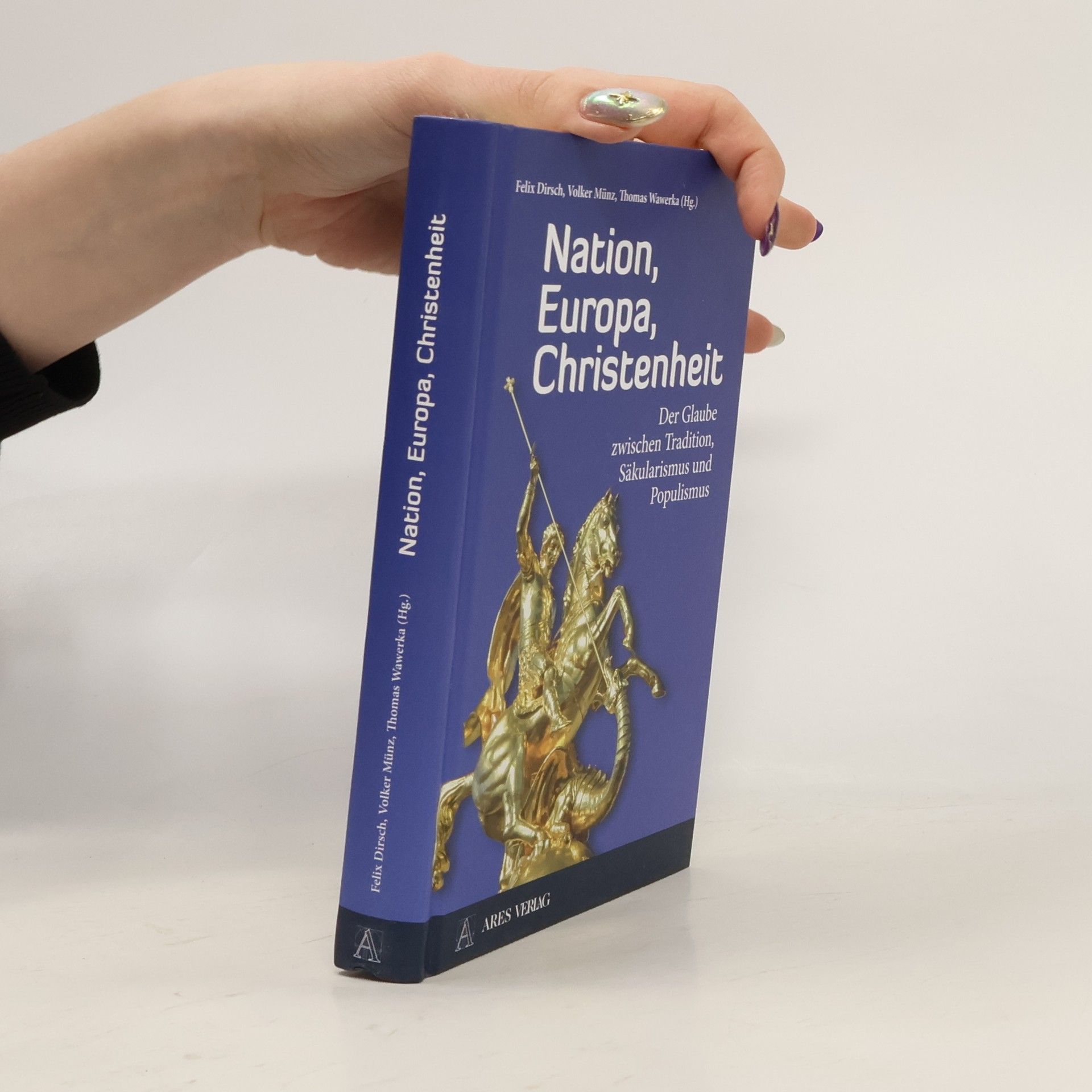
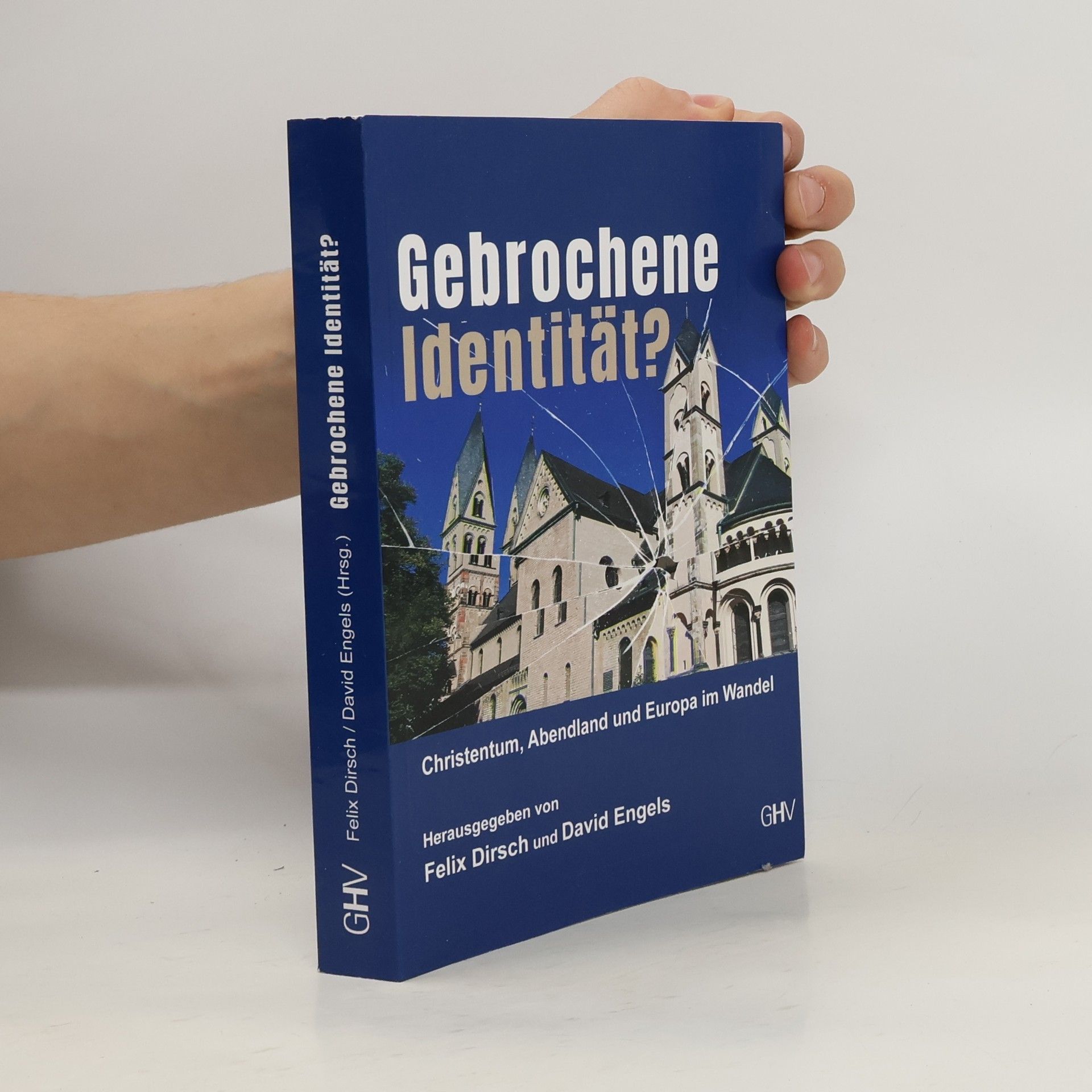


Logiken des Wandels
Teil 1
Gebrochene Identität
Christentum, Abendland und Europa im Wandel
Nation, Europa, Christenheit
Der Glaube zwischen Tradition, Säkularismus und Populismus
- 240pages
- 9 heures de lecture
In zahlreichen europäischen Ländern kommt es zum vermehrten Widerstand gegen die Vorstellungen linker und liberaler Eliten. Selbst auf globaler Ebene werden „populistische“ Strömungen festgestellt, deren gemeinsamer Nenner vor allem darin besteht, breiten Schichten der Bevölkerung einen größeren Anteil an der politischen Entscheidungsfindung verschaffen zu wollen. In diese große Auseinandersetzung unserer Zeit – „wir hier unten“ gegen „die da oben“ – sind auch beide Kirchen involviert. Dabei kann niemand bestreiten, dass sich religiös-ethische Grundsätze nicht eins zu eins in den Bereich der Politik übertragen lassen. Dennoch versuchen liberale Theologen üblicherweise, die universalistische Ausrichtung des Christentums samt Gebot der Nächstenliebe in die Mitte ihrer – politischen – Deutung zu stellen. Doch stehen die Ziele des globalen Liberalismus der christlichen Weltanschauung diametral entgegen: ein multilaterales Handelsnetzwerk, länderübergreifende politische Eingriffe und schrankenlose Migration. Eine Klärung ist dringend geboten. Vor dem Hintergrund von mehr als 2000 Jahren christlich-abendländischer Kultur beleuchtet „Nation, Europa, Christenheit“ den traditionsreichen Dreiklang des Titels ebenso wie das Verhältnis „rechter Christen“ zu Volk und Staat. Mit Beiträgen von Volker Münz (MdB), Prof. Dr. Felix Dirsch, Marc Stegherr, Jaklin Chatschadorian und anderen.
Rechtes Christentum?
Der Glaube im Spannungsfeld von nationaler Identität, Populismus und Humanitätsgedanken
- 250pages
- 9 heures de lecture
Der Sammelband Rechtes Christentum? setzt dieser Instrumentalisierung des Glaubens gegen politisch unliebsame Positionen zahlreiche kluge Stimmen parteigebundener und freier Rechtskonservativer entgegen, die wohlbegründet ganz andere Positionen vortragen. Mit Beiträgen von Matthias Matussek, Prof. Dr. David Engels, Prof. Dr. Harald Seubert und Martin Lichtmesz und vielen mehr.
Die Stimmen der Opfer
Zitatelexikon der deutschsprachigen jüdischen Zeitzeugen zum Thema: Die Deutschen und Hitlers Judenpolitik