Michael G. Fritz Livres
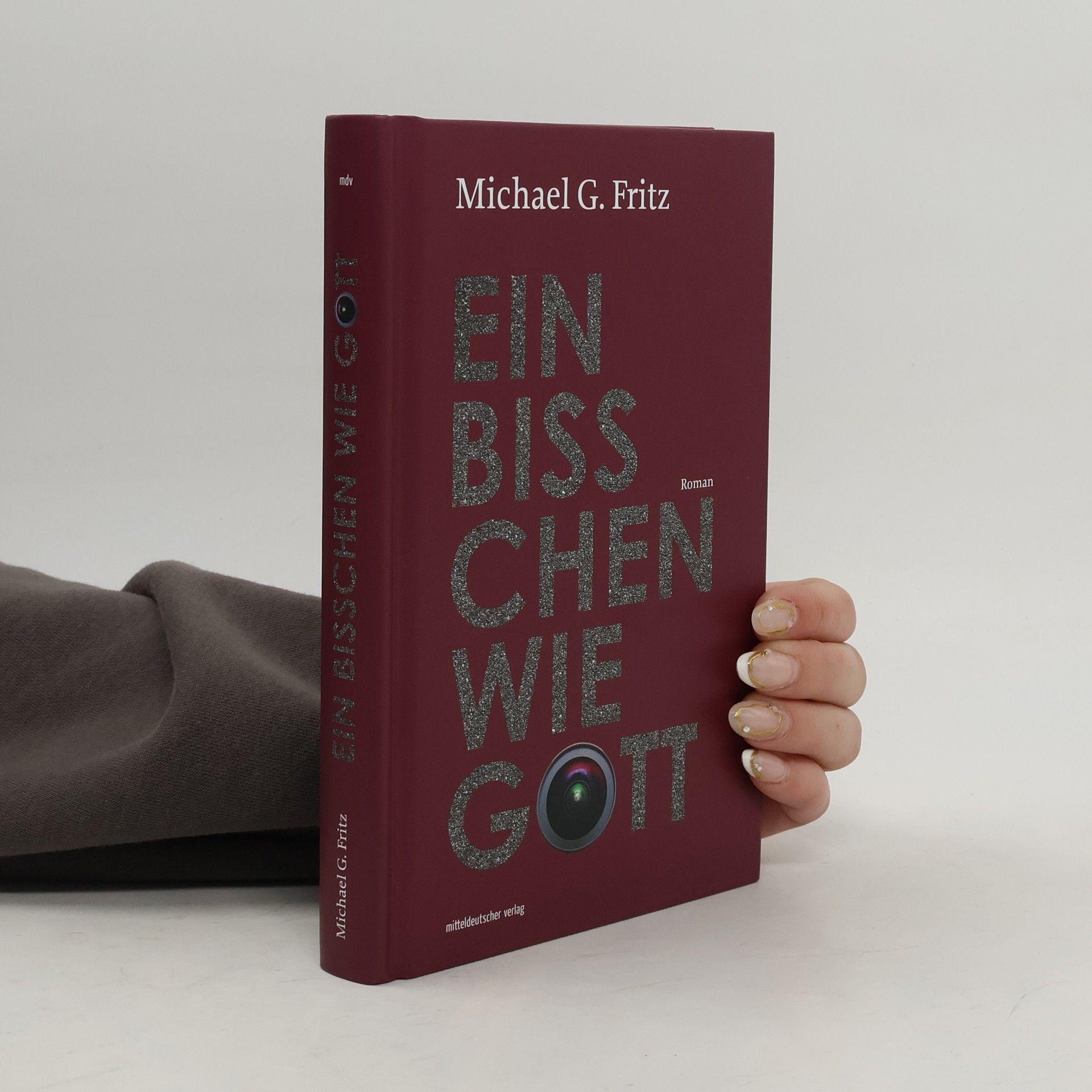

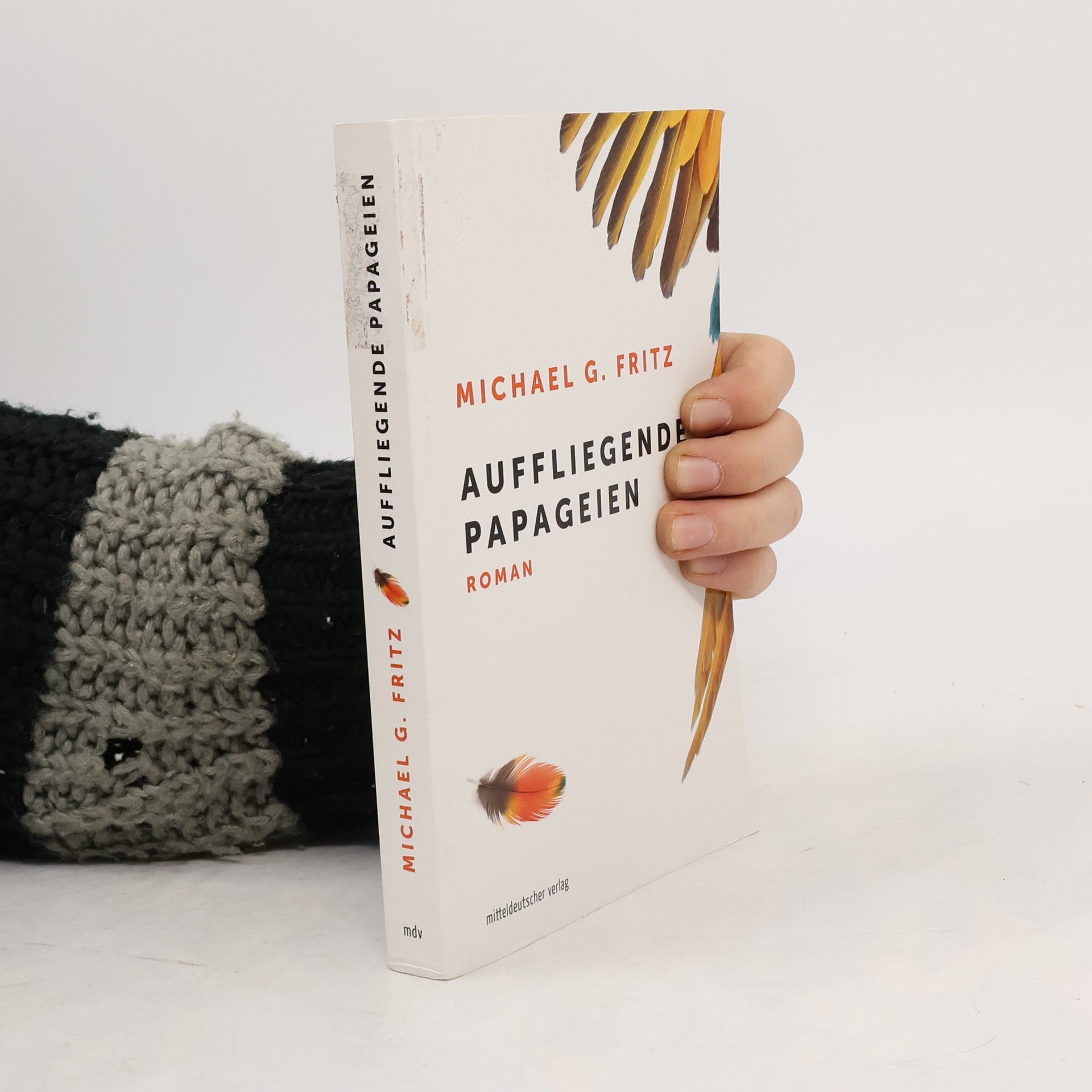
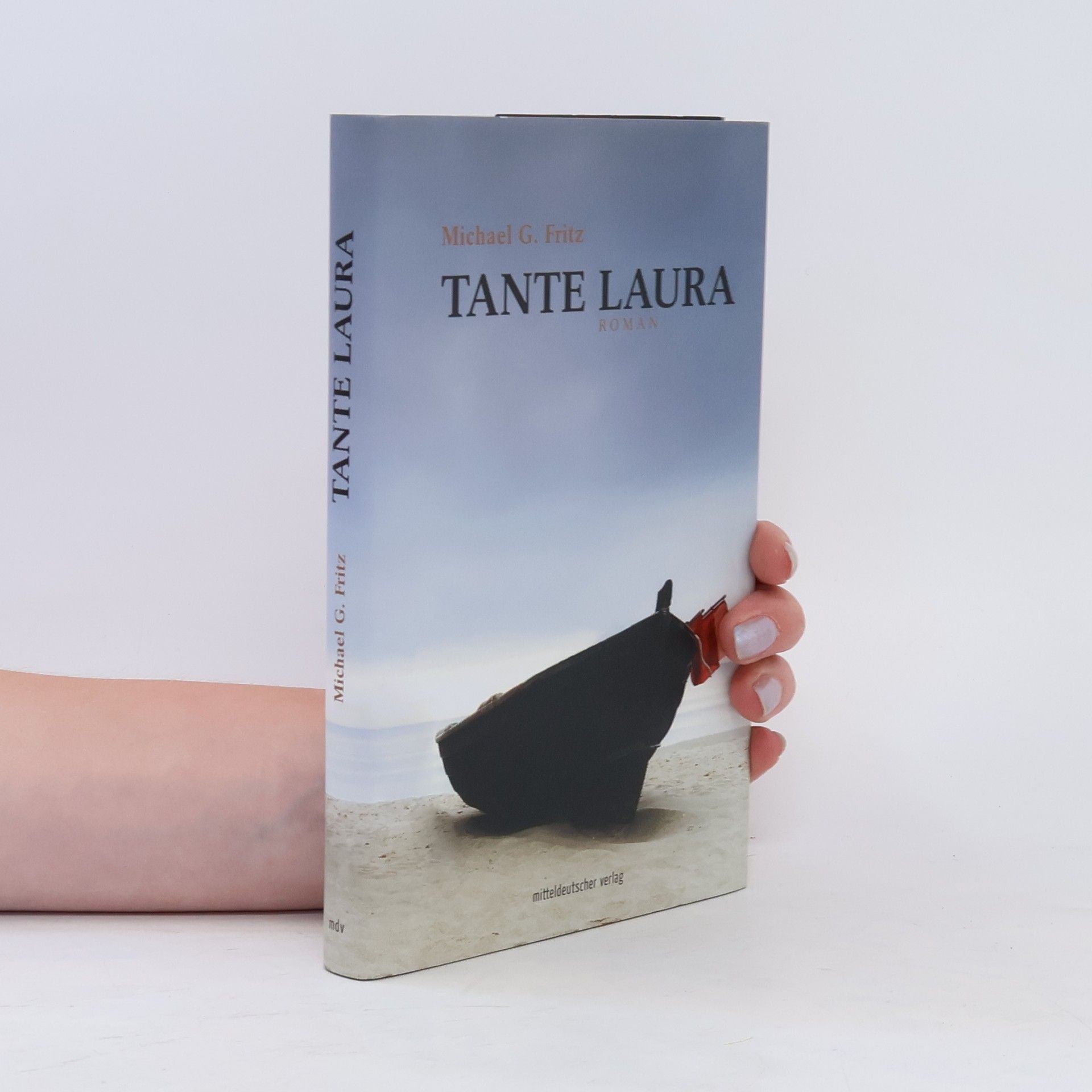

Tante Laura
Roman
Plötzlich sind nebenan gebauschte Laken zu sehen und der leichte Sommerwind trägt Rock-and-Roll-Klänge an ihren Frühstückstisch. Aber der Nachbar hat noch nie Feriengäste beherbergt. Bald darauf stellt sich heraus, dass die Frau nackt sein muss, die sich hinter den Stofffahnen der Sonne hingibt. Martin und seine Frau Katja, die mit ihren Söhnen Robert und Florian schon seit Jahren beim alten Jeske im Haus am Bodden den Urlaub verbringen, können gar nicht anders als neugierig sein. Außer dass Martin fast jeden Morgen mit Jeske zum Angeln aufs Wasser fährt, passiert in einem abgelegenen Ort an der Ostsee nicht viel. Aber das ändert sich, als sich in der unbekannten Frau Martins längst vergessene Tante Laura zu erkennen gibt: die jüngere Schwester von Martins Mutter, irgendwann nach Südamerika ausgewandert. Plötzlich geht es um Leben und Tod. Michael G. Fritz hat nach seinem großen Erfolg mit 'Die Rivalen' wieder einen Roman geschrieben, der dem Leser alles bietet: ein Erzählen über das Leben, wie es der Leser kennt und liebt, bis es seine geheimen Geschichten offenbart.
Eine Vierecksgeschichte um alte und neue Liebe in zwei Systemen Wie ist es, wenn die neue Freundin das gleiche Papageien-Tattoo trägt wie die Frau, die einen nach vielen gemeinsamen Jahren verlassen hat. Stellen die beiden farbenprächtigen Vögel einen Zusammenhang zwischen den Frauen her? Sind sie ein Zeichen? Und wofür? Im Zentrum des Romans steht die Geschichte von Arno und Angelika, die sich vor über fünfzig Jahren als Nachbarskinder an der Ostsee gefunden haben. Bis zur Wende waren sie ein Paar. Doch von einem Tag auf den anderen verlässt Angelika ihren Arno mit ihrem Geliebten Gussew. Über seine neue Freundin Lilly findet Arno wieder die Spur zu Angelika. Noch immer ist sie mit Gussew liiert, der inzwischen Immobiliengeschäfte betreibt. Michael G. Fritz erzählt mit Fabulierfreude gleichnishaft und mit sinnlicher Sprache eine große Liebesgeschichte, in der ein nahezu vergessenes und zugleich einflussreiches Stück untergegangen geglaubter Welt weiterlebt.
Meinen Apfelstrudel sollten Sie sich nicht entgehen lassen
Schalom. Begegnungen in Israel
Auf vielen Reisen durch Israel hat Michael G. Fritz Menschen kennengelernt, die bereit waren, sich ihm zu öffnen und ihre Biografie ebenso wie ihre Vorstellungen vom Leben in ihrem Land zu teilen. Wie lebt es sich in Israel, in einer Region, die auf mehr als viertausend Jahre zurückblickt und sich so sehr aus der eigenen Geschichte heraus definiert? Fritz erzählt authentische Geschichten, die Land und Leute den Leser*innen näherbringen. Marko Martin im Nachwort: „Die Protagonisten in diesem klug, das heißt unaufdringlich komponierten Buch sind dabei keine eindimensionalen Thesengestalten, sondern Menschen in ihrer unverwechselbaren Individualität.“
Ein bisschen wie Gott
- 240pages
- 9 heures de lecture
An dem Tag, als Johanna an die Bildschirme der Überwachungskameras eines Berliner Bahnhofs umgesetzt wird, beobachtet sie auf einem Bahnsteig ihren Mann André, der eine fremde Frau küsst. Johanna glaubt, durch den Anblick endgültig verrückt zu werden – wie ihre Großmutter. Sie befürchtete es schon immer, ihre Mutter Erika hatte es ihr vorausgesagt. Nun scheint es einzutreten. Michael G. Fritz antwortet auf seine Wahrnehmungen in Zeiten der Überwachung mit einem Roman über ein bitteres Familien geheimnis, in dem er gekonnt und unterhaltsam mit der Wirklichkeit auf den Monitoren zu spielen weiß.