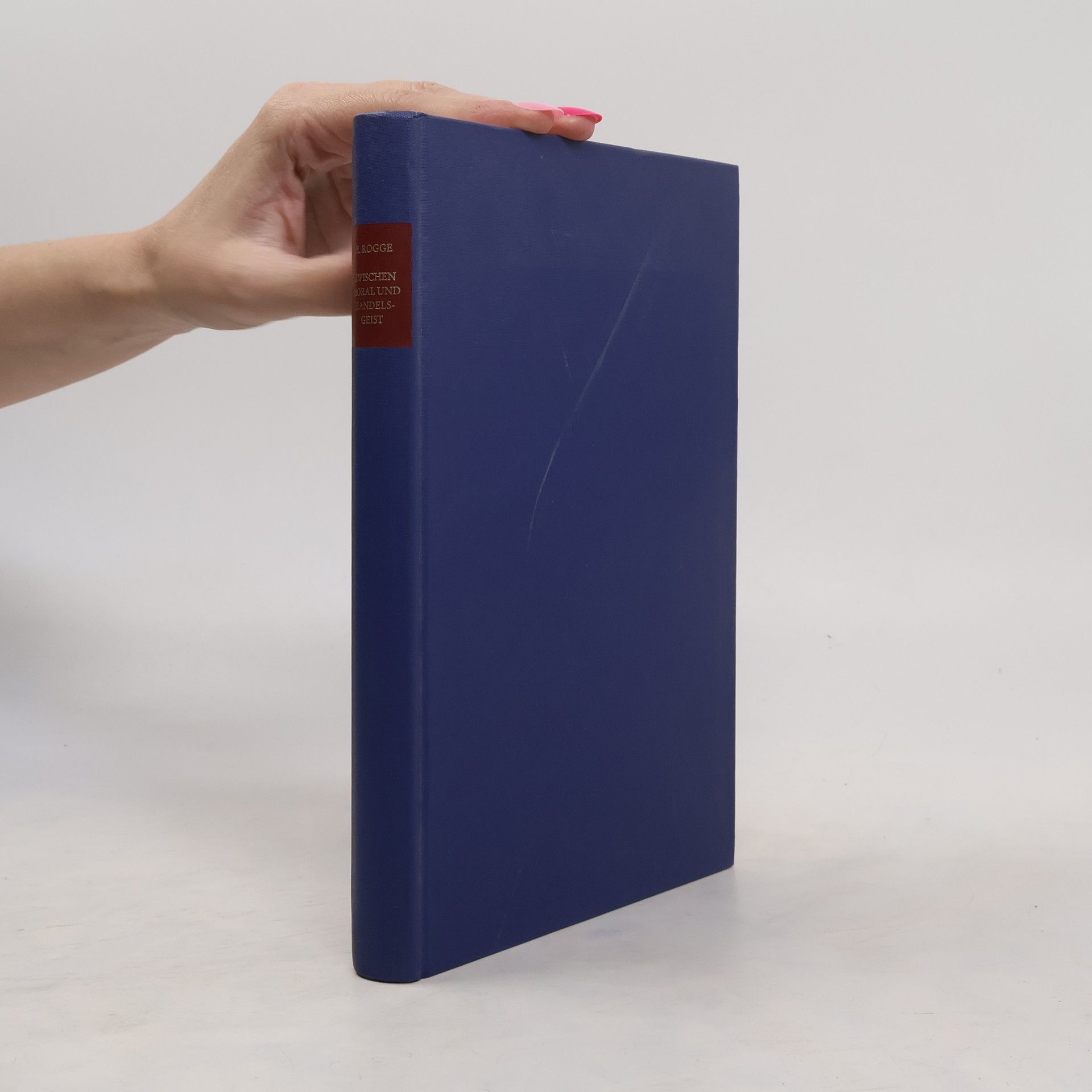Das Recht ist keine „geschlechtsneutrale“ Instanz, sondern hat die Verhältnisse und das Verhalten von Männern und Frauen über die Jahrhunderte geprägt. Im Rechtsleben einer Gesellschaft spiegeln sich Vorstellungen und Konflikte über geschlechtsspezifische Rollen und Einflussbereiche wider; die materielle und symbolische Aufgabenteilung zwischen den Geschlechtern reflektiert politische Interessen und soziale Hierarchien. Die Autorin untersucht anhand des hamburgischen Stadtrechts die Themen „Frauenrechte und Frauenbesitz bei der Eheschließung“, „Frauenbesitz und Geschlechterbeziehungen in der Ehe“ sowie „Frauen und nichteheliche Sexualbeziehungen“ zwischen dem 13. und 16. Jahrhundert. Die politischen Repräsentanten Hamburgs, die seit dem 13. Jahrhundert unabhängig regierten, schränkten die Möglichkeiten verheirateter Frauen ein, frei über ihr Vermögen zu verfügen. Alleinstehende Frauen wurden zunehmend als fürsorgebedürftige Gruppe wahrgenommen. Die ungleiche rechtliche Behandlung außerehelicher Sexualbeziehungen von Frauen und Männern verdeutlicht die Geschlechtermoral in politischen und religiösen Auseinandersetzungen. Die „Kaufmannsrepublik“ Hamburg baute ihren Machtzuwachs zwischen dem 13. und 16. Jahrhundert wesentlich auf die Einschränkung der ökonomischen und sexualmoralischen Handlungsspielräume der Stadtbewohnerinnen. Abschließend wird die Bedeutung der Epochengrenze zwischen Mittelalter und Neuzeit in Bezug auf den Wa
Roswitha Rogge Livres