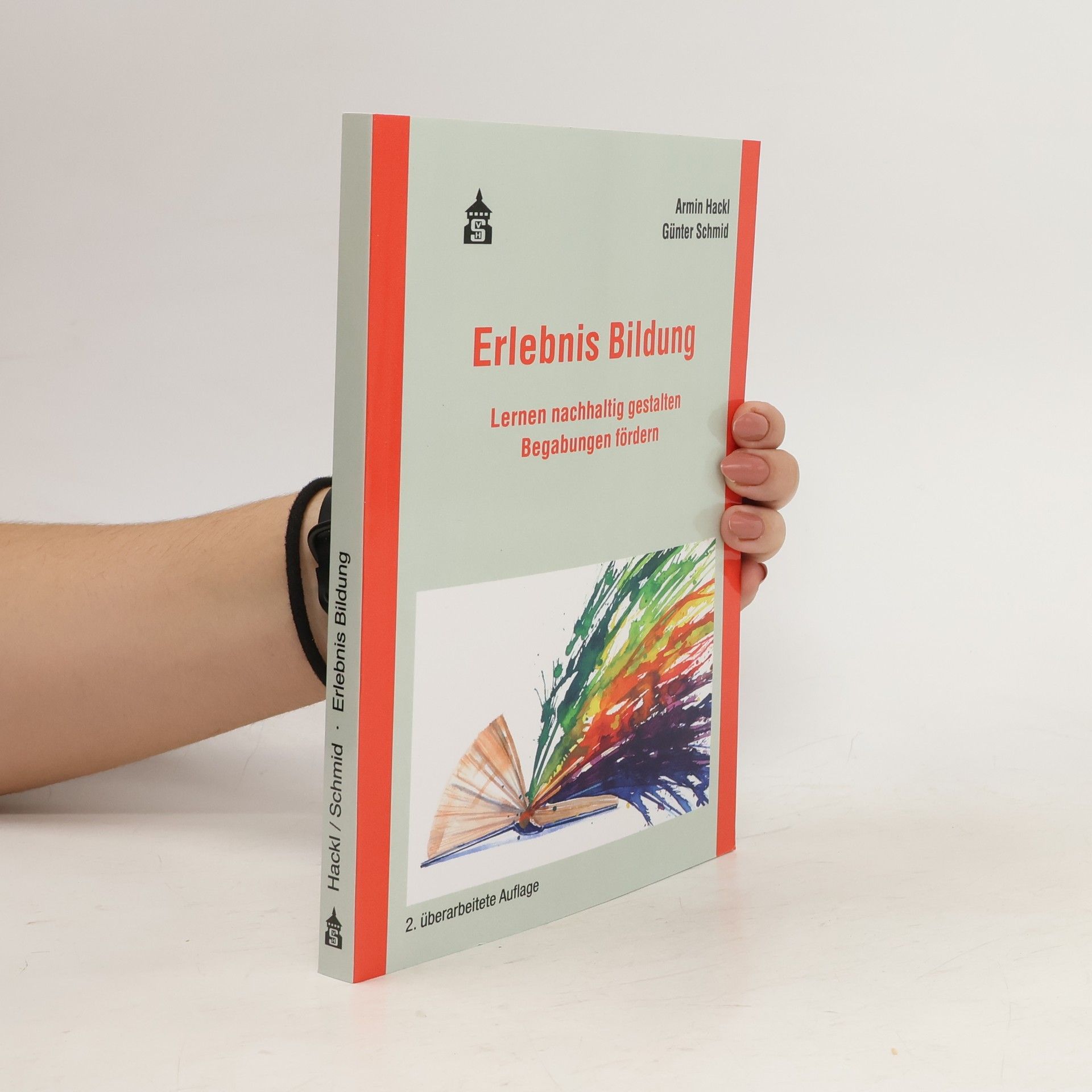Wie kann Lernen nachhaltig und Bildung zum Erlebnis werden? Auf diese Frage versucht dieses Buch Antworten zu finden. Dabei folgt es der Idee einer Schule der Person, die davon ausgeht, dass Schule vom Lernenden her zu denken ist. Auf dieser Grundlage entfaltet es eine neue Sicht schulischer Begabungsförderung, die nicht bei der Individualisierung stehen bleibt. Beziehung, Entscheidung in verantworteter Freiheit, Gestaltung und multidimensionale Leistung werden dabei zu den zentralen Feldern einer personorientierten Schulentwicklung. An erprobten Formen und exemplarischen Beispielen wird die Umsetzung dieses Konzepts einer Schule, in der der „Eigen-Sinn“ ebenso bedeutsam ist wie der „Gemein-Sinn“, vorstellbar. Ausgewählte Modelle und didaktische Konzepte ergänzen die Praxis „erlebten Lernens“.
Armin Hackl Livres