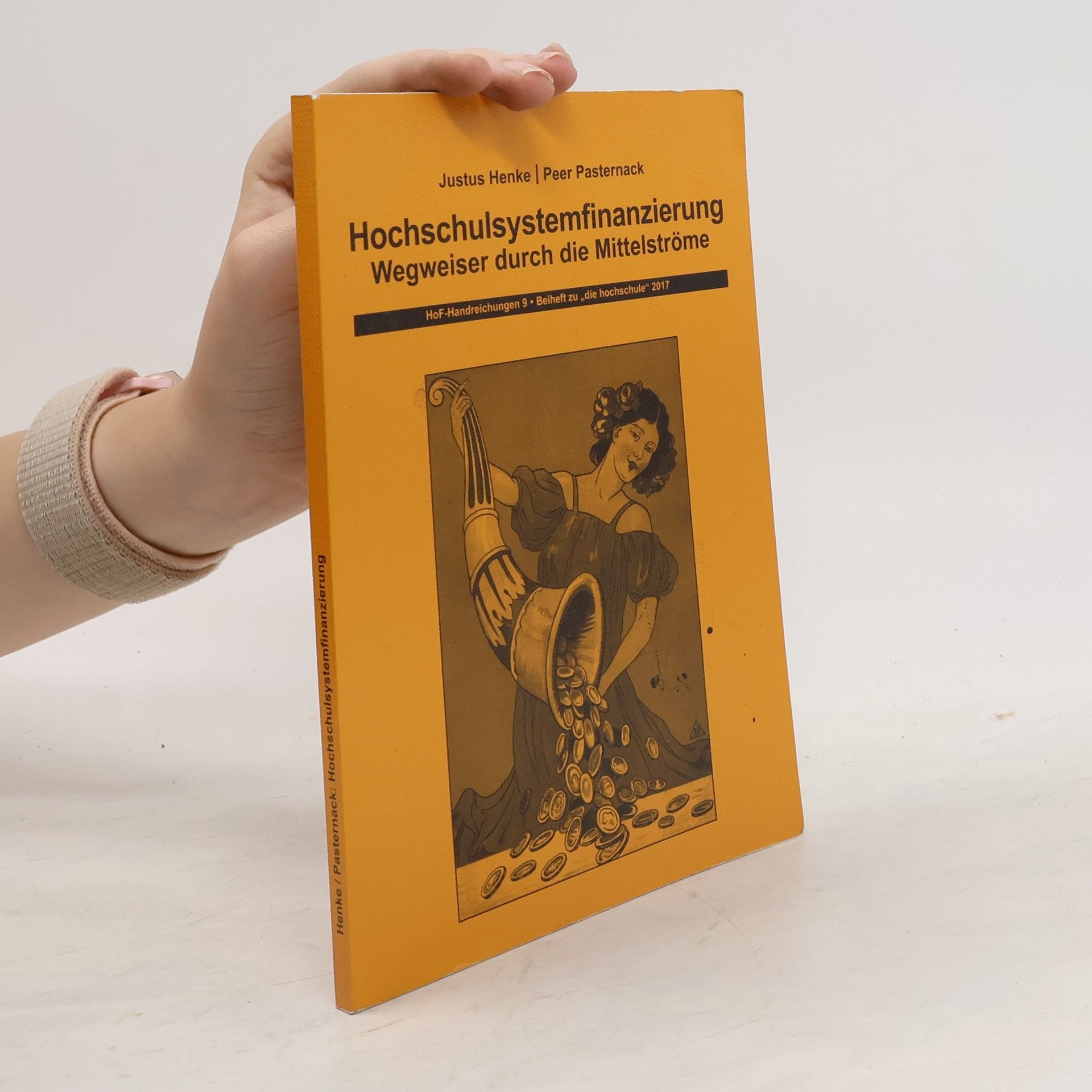Wie die Hochschulen durch das Zeitalter des Frühdigitalismus kommen
Basiswissen für die avancierte Organisationsgestaltung in 94 Fragen und Antworten
Dieses Buch bietet Basiswissen für die Organisationsgestaltung in 94 Fragen mit den dazu passenden kompakten Antworten von Expertinnen und Experten zum betreffenden Thema. Die leitende Perspektive ist: Digitalisierung muss ebenso als technischer wie als sozialer Prozess realisiert werden. An Hochschule treffen eindeutige Algorithmen auf vieldeutige Abläufe. Die Autoren und Autorinnen halten nicht alles deshalb für umsetzungsbedürftig, nur weil es digital ist. So ergibt sich eine Grundstimmung des Abwägens von Kosten und Nutzen.