Mit viel Fantasie und nur wenigen Mitteln entstehen aus nutzlosen Pappkartons und ausrangierten Haushaltsgegenständen begehrte Kinder-Spielwelten. Ob Küchenzeile, Schminktisch, Cabrio oder Fernseher - hier können Kinder gemeinsam mit den Erwachsenen an der Erfüllung ihrer Spiel-Wünsche werkeln. Die zahlreichen Ideen inspirieren und regen zu eigenen Kreationen an. 64 Seiten, 20,5 x 26,5 cm, Hardcover mit Ausstanzung
Claudia Scholl Livres

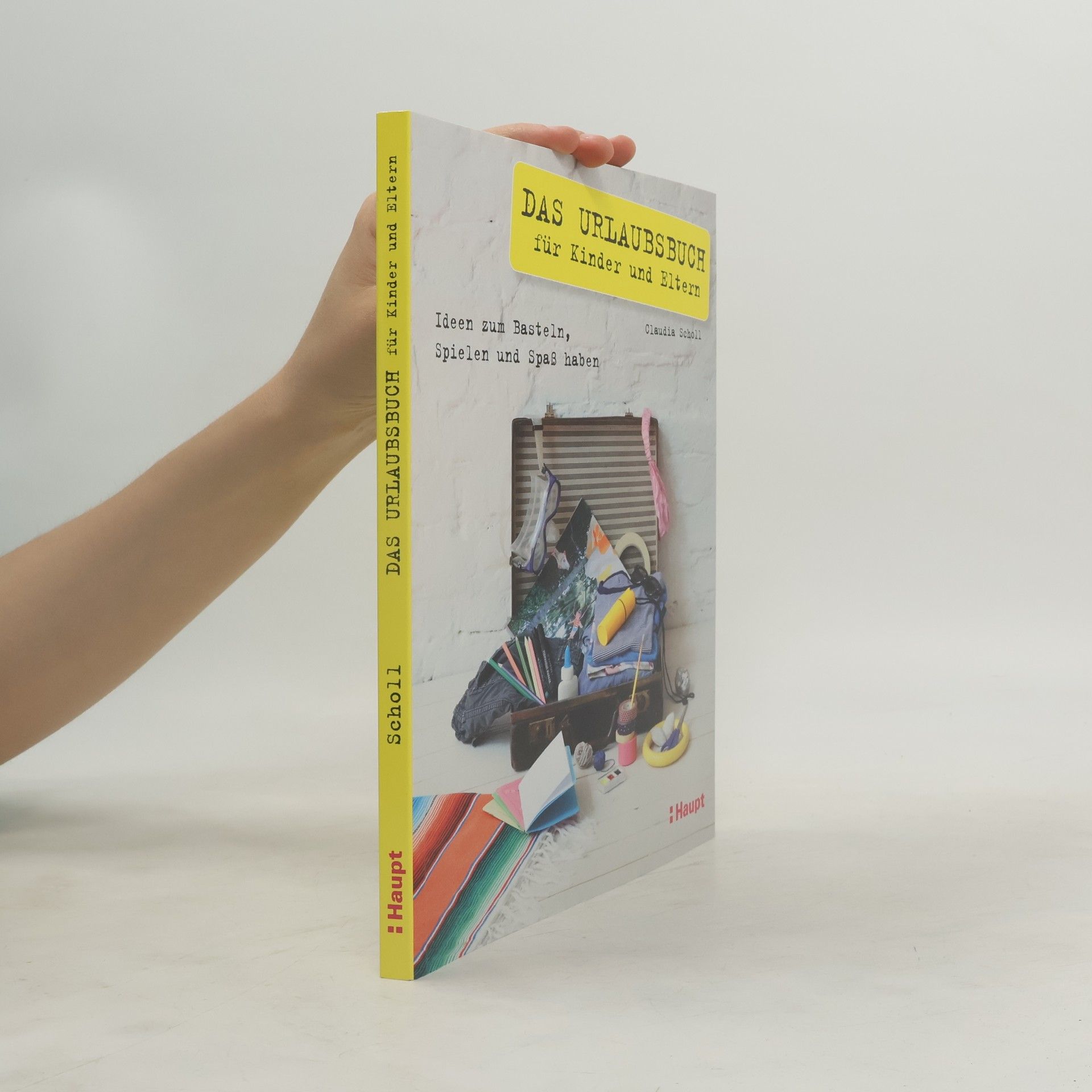

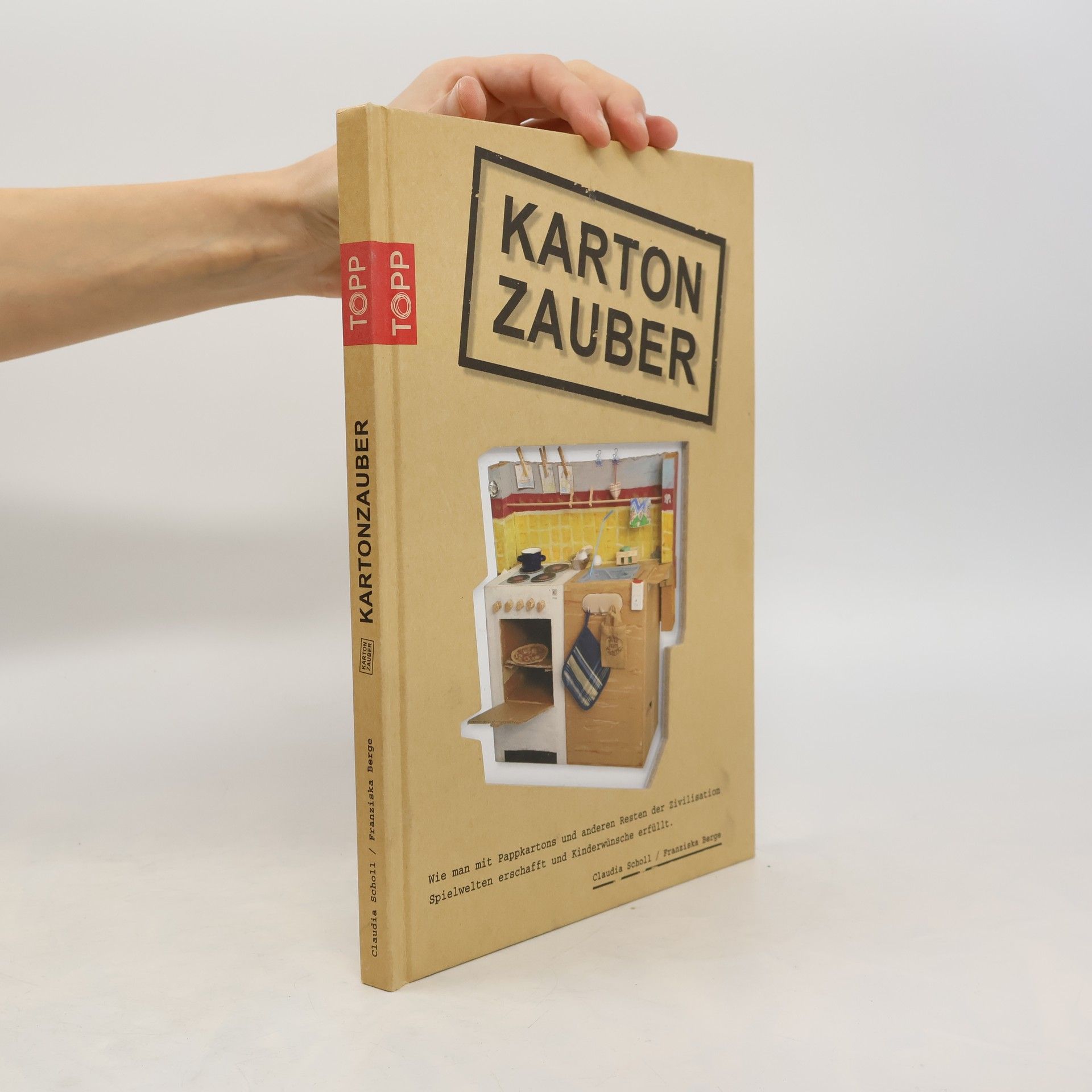
Was haben eine Tierarztpraxis, eine Ritterburg und ein Friseursalon gemeinsam? Sie haben - jedenfalls hier - alle auf einem Quadratmeter Platz. Aus Pappe und weiteren Recyclingmaterialien lassen sich fantasievolle Spielwelten zu allen möglichen Lieblingsthemen bauen. Bereits junge Bauleiter haben schon prima Ideen, welche die Großen dann mit Hilfe der Kleinen umsetzen können. Oder die Kinder kreieren ihr Kaufhaus, den Tischkicker oder die Trauminsel ganz alleine oder in einer Gruppe. Denn das Bauen gehört schon zum Spielen, und wenn etwas nicht mehr funktioniert, lässt sich Pappe leicht reparieren. Ist der Kiosk, die Kegelbahn oder das Inselparadies nicht mehr aktuell, lässt sich die Spielwelt leicht verändern, verschenken oder auch entsorgen. 35 tolle Ideen für Kindern ab 5 Jahren.
Der Urlaub steht vor der Tür? Super, dann kommt dieses Buch gerade richtig! Denn es enthält ganz viele Vorschläge, was man außer Faulenzen, Schwimmen, gut Essen und tolle Sehenswürdigkeiten Ansehen noch machen kann. Ein Buch voller kreativer Projekte, die Kinder einfach herstellen können, mit künstlerischen Ansätzen, wie man aus Dingen vor Ort etwas Neues gestaltet, sowie Tipps und Tricks rund um den Urlaub. Je nachdem, ob die Reise ans Meer, in die Berge, in die Stadt, in den Schnee, in fremde Welten oder ins nahe Umland führt, unterscheiden sich auch die Ideen. Sie reichen vom Skizzieren der aktuellen Bademode über den Karton-Rucksack und das Kochlöffeltheater bis zur Halskette aus buntem Bonbonpapier. Und wer die schönen Muster auf Mauern, Gehwegen oder Textilien nicht vergessen will, hält sie im selbst gemachten Skizzenbuch fest. Dieses Buch beginnt an der Stelle, an der der Familie die tollen Ideen ausgehen. Es wird gebastelt, entdeckt und verwertet - in der Gruppe oder für sich selbst. Und es soll die ganze Familie inspirieren, den Urlaub noch schöner zu gestalten.
Hubschrauber und Eisladen, Setzkasten und Kringelkette, Stuhl und Schinkenbrötchen - diese und viele weitere Ideen für Spielobjekte, Geschenke, Möbel, Kunst und Deko lassen sich fantasievoll aus Karton, Pappe und Papier herstellen. Die verwendeten Recyclingmaterialien sind günstig und fördern die Kreativität - und sie besitzen einen ganz eigenen Charme. Viele Ideen können von den Kindern allein oder in Gruppen umgesetzt, abgewandelt und ergänzt werden. Bei weiteren Projekten ist die Mithilfe von Erwachsenen gefragt, da Heißkleber oder Cutter verwendet werden. So entstehen individuelle Objekte zum Spielen, Verschenken oder für das eigene Pappenheim.