Erich Ribolits Livres
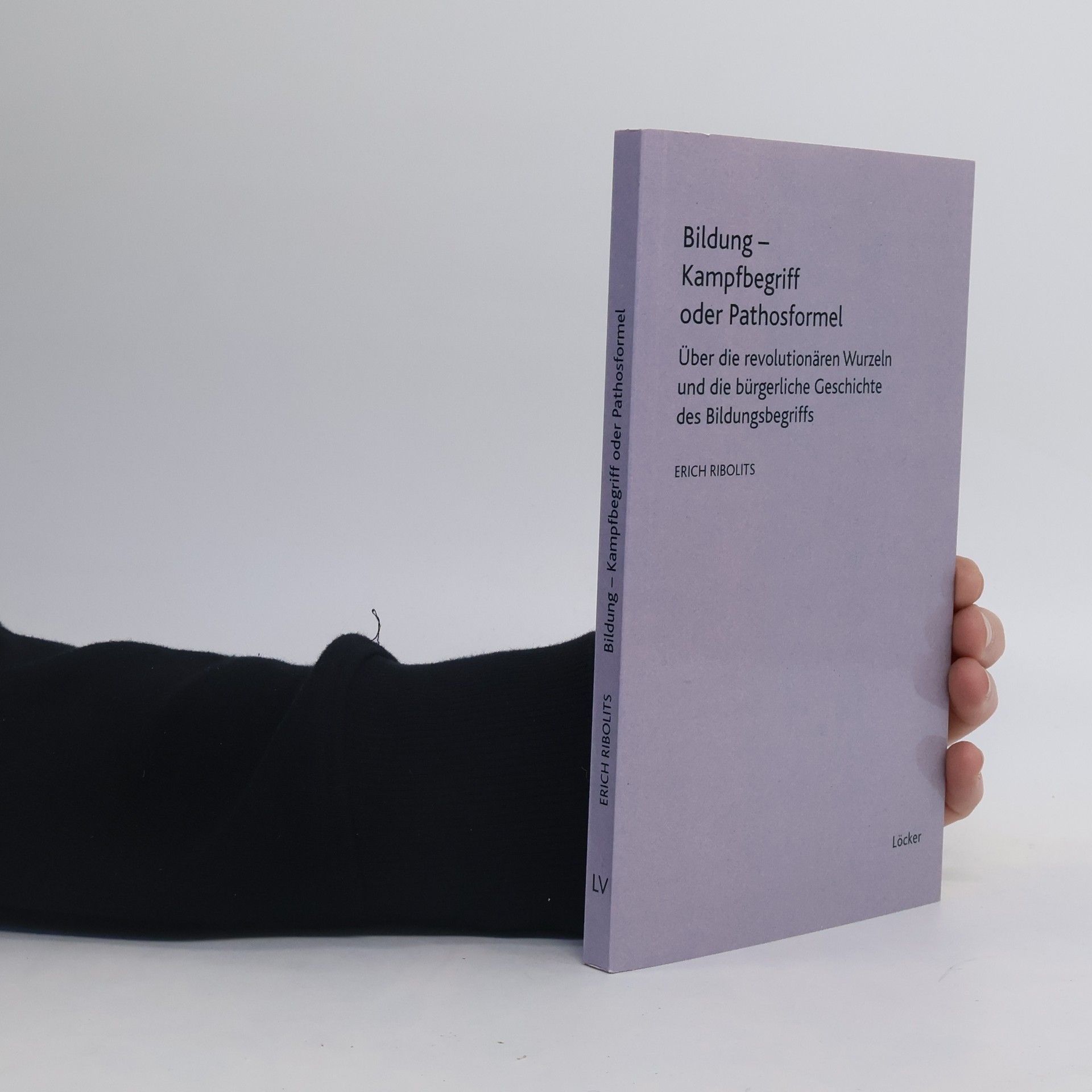

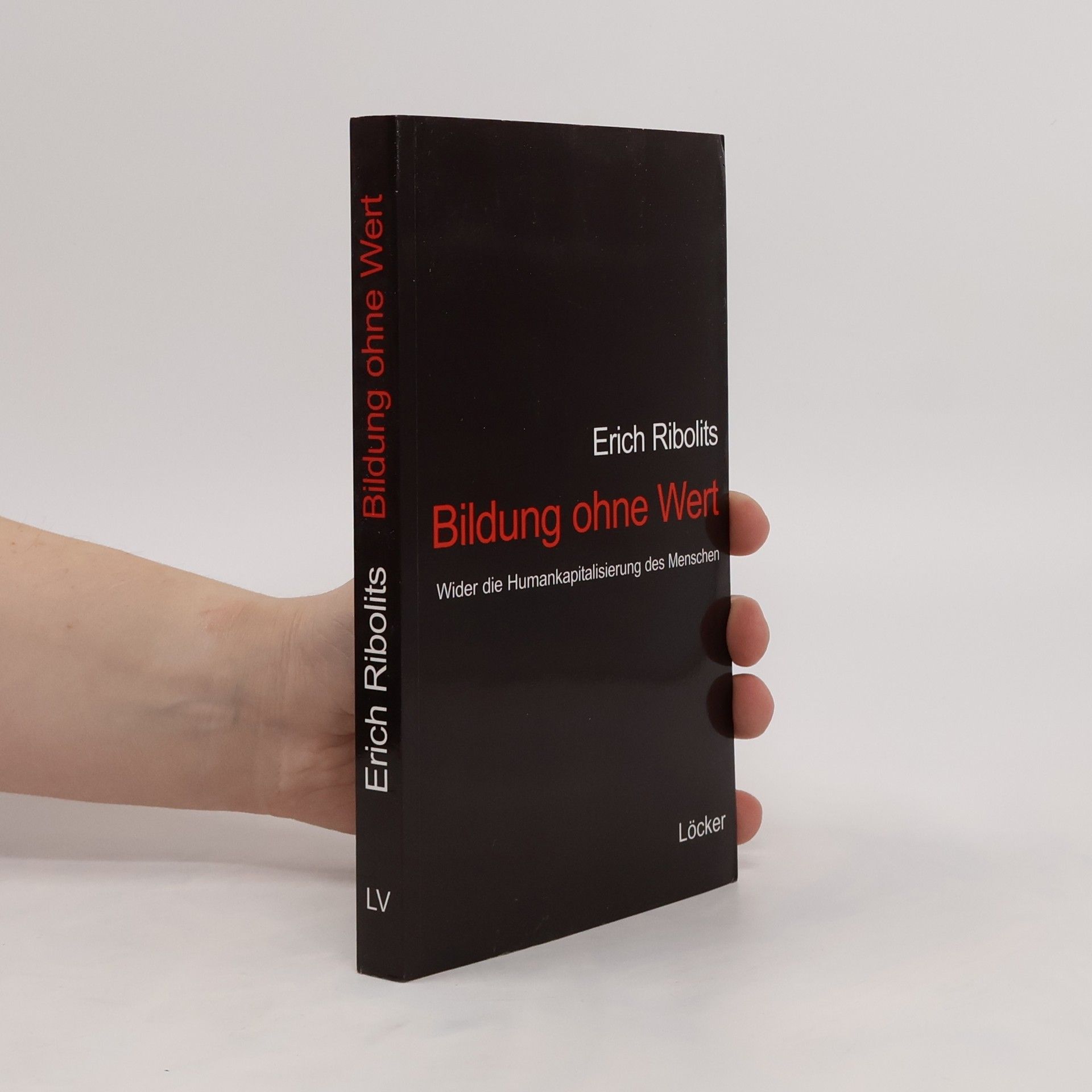
Bildung - Kampfbegriff oder Pathosformel
Über die revolutionären Wurzeln und die bürgerliche Geschichte des Bildungsbegriffs
Der Autor verdeutlicht, dass Bildung schon lange als Ware betrachtet wird. Die ökonomische Nutzung der menschlichen Fähigkeit, sich durch Lernen zu formen, spiegelt sich im Bildungsbegriff wider. In den letzten Jahren beklagen bildungsbewusste Kreise den Verlust der Orientierung an humanistisch gebildeten Individuen in Schulen und Universitäten. Bildung wird zunehmend ökonomisch argumentiert und reduziert sich auf eine Ware. Die aktuellen Reformen im Bildungssystem sind stark auf Effektivität und die Schaffung verwertbaren Humankapitals ausgerichtet. Mit minimalen Ressourcen sollen Absolventen produziert werden, die besser auf den Arbeitsmarkt zugeschnitten sind. In Reaktion auf diese ökonomische Sichtweise neigen Befürworter der Bildung dazu, vergangene Zustände zu idealisieren und von einer einst heilen Bildungswelt zu träumen. Das Buch widerspricht dieser Nostalgie. Neu ist, dass Produktivitätssteigerung, Globalisierung und eine wachsende Verwertungskrise die Konkurrenz zwischen Individuen, Regionen und Staaten verschärfen, was den ideologischen Überbau des organisierten Lernens obsolet macht. Der machtkritische Nimbus des Bildungsbegriffs schwindet, und das Bildungssystem wird als das erkannt, was es ist: eine Institution zur Herstellung des bürgerlichen Subjekts, das Vernunft und ökonomisches Kalkül gleichsetzt und die Welt nur unter dem Aspekt des Geldwerts versteht.