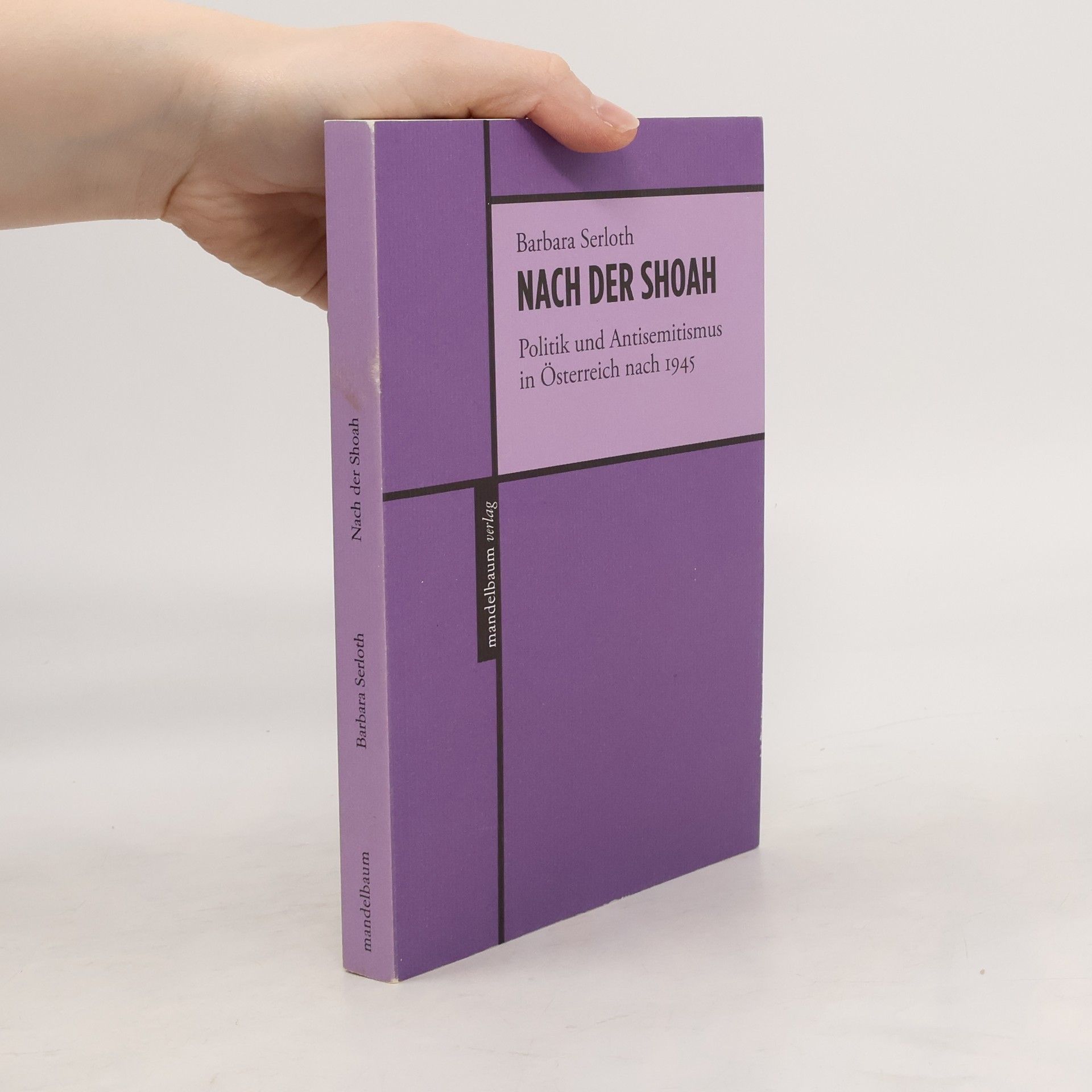Von Opfern, Tätern und jenen dazwischen
Wie Antisemitismus die Zweite Republik mitbegründete
Es stellt sich nicht die Frage, ob es im Österreich der Nachkriegsjahre Antisemitismus gab, sondern welchen Einfluss er auf die Konstruktion der Zweiten Republik hatte. Der aktive und nicht-aktive Antisemitismus der politischen Eliten offenbarte sich in den Willensbildungsprozessen rund um die Entnazifizierung, die widerwillige Restitution oder die nicht erfolgte Einladung zur Rückkehr in die alte Heimat. Die Autorin macht in diesem Band die politischen Prozesse anhand der stenographischen Protokolle des Nationalrats gut nachvollziehbar. Es zeigt sich deutlich, dass die politischen Eliten Juden nicht als gleichwertigen Teil der Gemeinschaft angesehen haben. Die neu gesetzten Normen begründeten eine Gesellschaft, in der sich der Nachkriegsantisemitismus in neuem, angepassten und nichtsdestotrotz diskriminierendem und aus grenzendem Gewand zeigte.