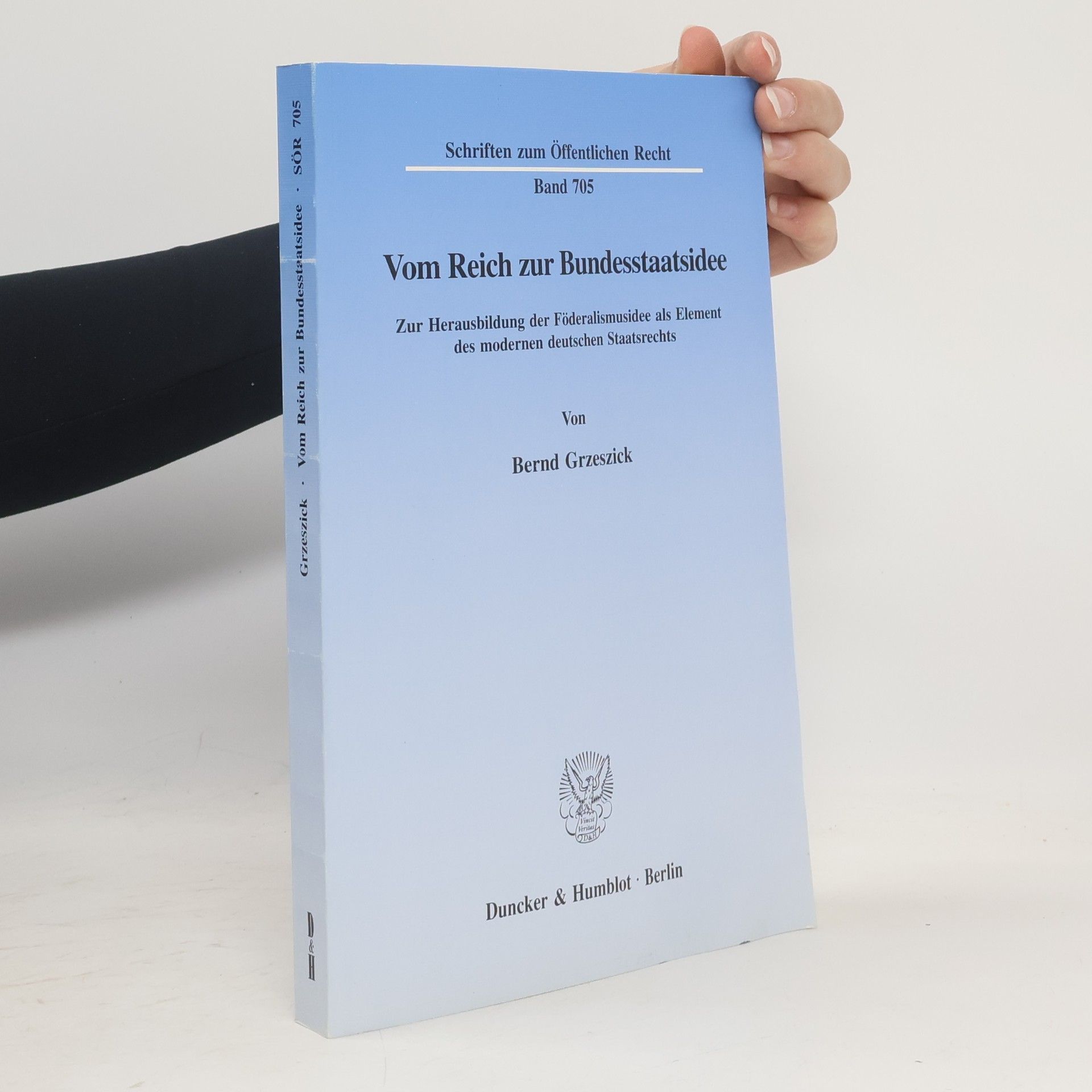Sozialkassenverfahren und Verfassungsrecht
Zur Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes zur Sicherung der Sozialkassenverfahren im Baugewerbe sowie der allgemeinverbindlichen Tarifverträge über das Sozialkassenverfahren im Baugewerbe
Das Recht der Sozialkasseverfahren hat in der Praxis eine erhebliche Bedeutung. Dennoch hat das Rechtsgebiet in der juristischen Fachwelt bislang eher wenig Aufmerksamkeit erlangt. Zwei Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts vom September 2016, die auf verfassungsrechtlichen Ausfuhrungen beruhen, haben dies geandert. Aber auch uber die in den Entscheidungen und der folgenden Diskussion angesprochenen Aspekte hinaus stellen sich im Recht der Sozialkasseverfahren verfassungsrechtliche Fragen, die einer Aufarbeitung bedurfen. Dies ist der Gegenstand der vorliegenden Publikation, bei der die einschlagige Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom August 2020 bereits berucksichtigt ist.