Homo ferens. Frauen tragen
zur Kulturgeschichte des Tragens im historischen Tirol und in seinen Nachbarregionen

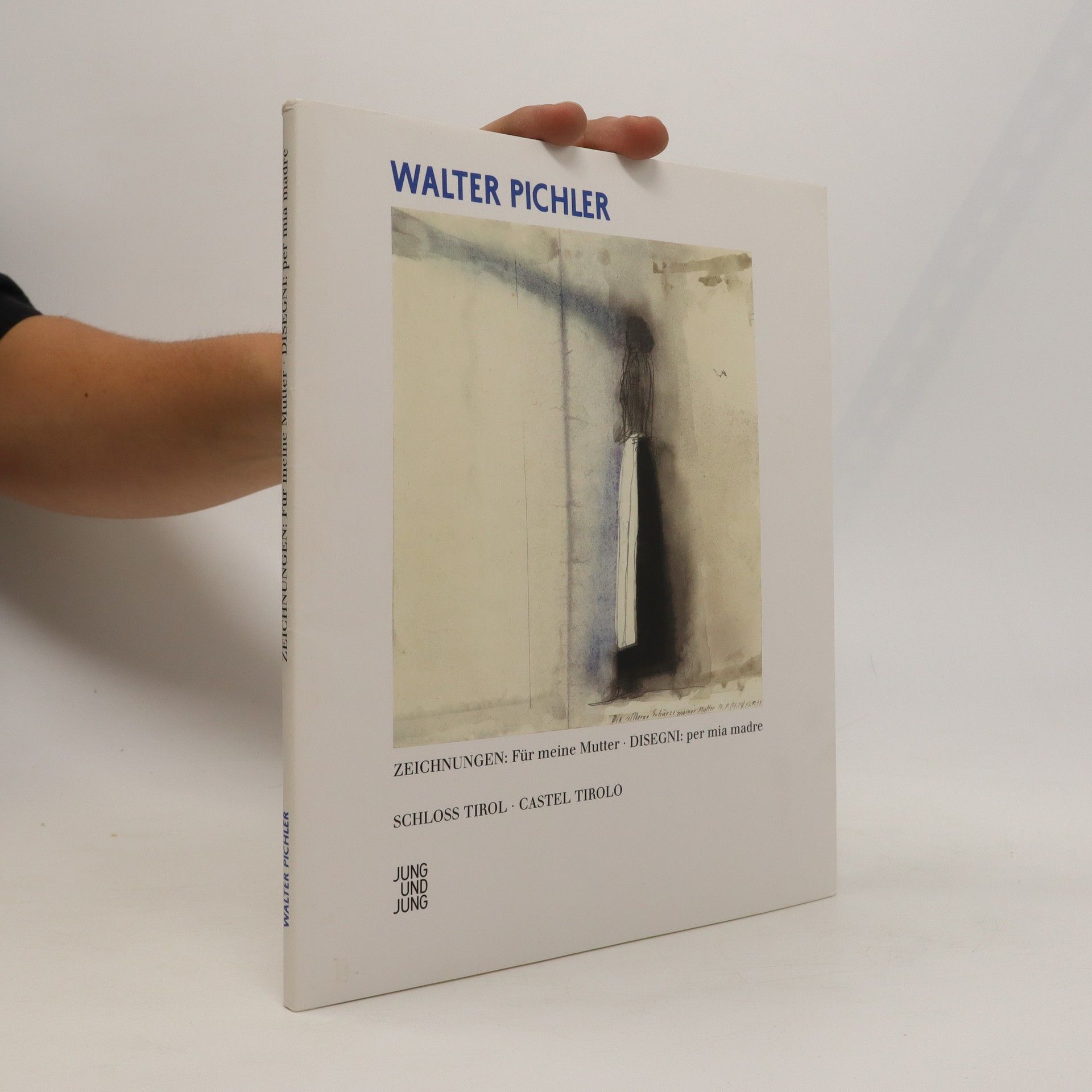
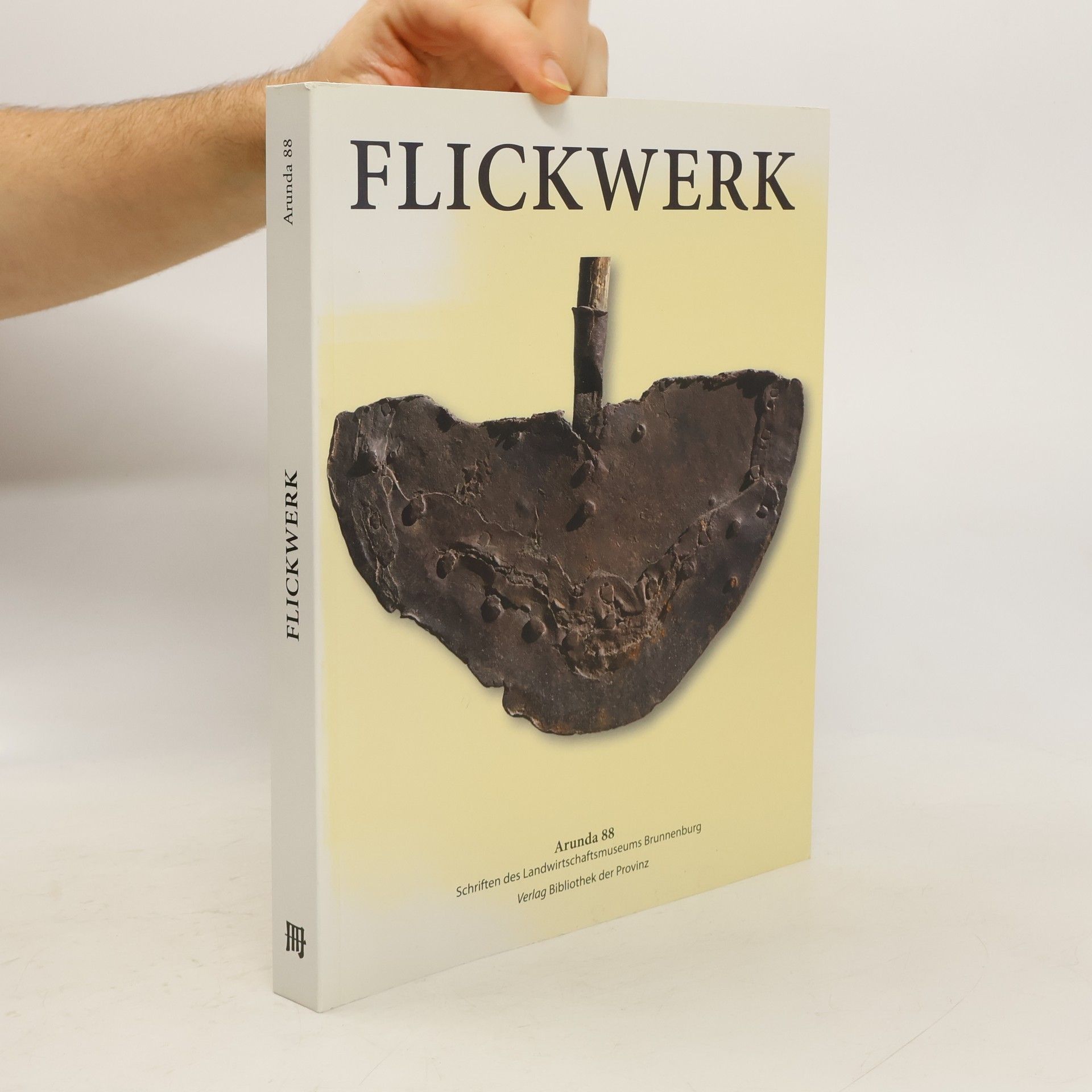

zur Kulturgeschichte des Tragens im historischen Tirol und in seinen Nachbarregionen
Zur Kulturgeschichte der Schärfe im historischen Tirol