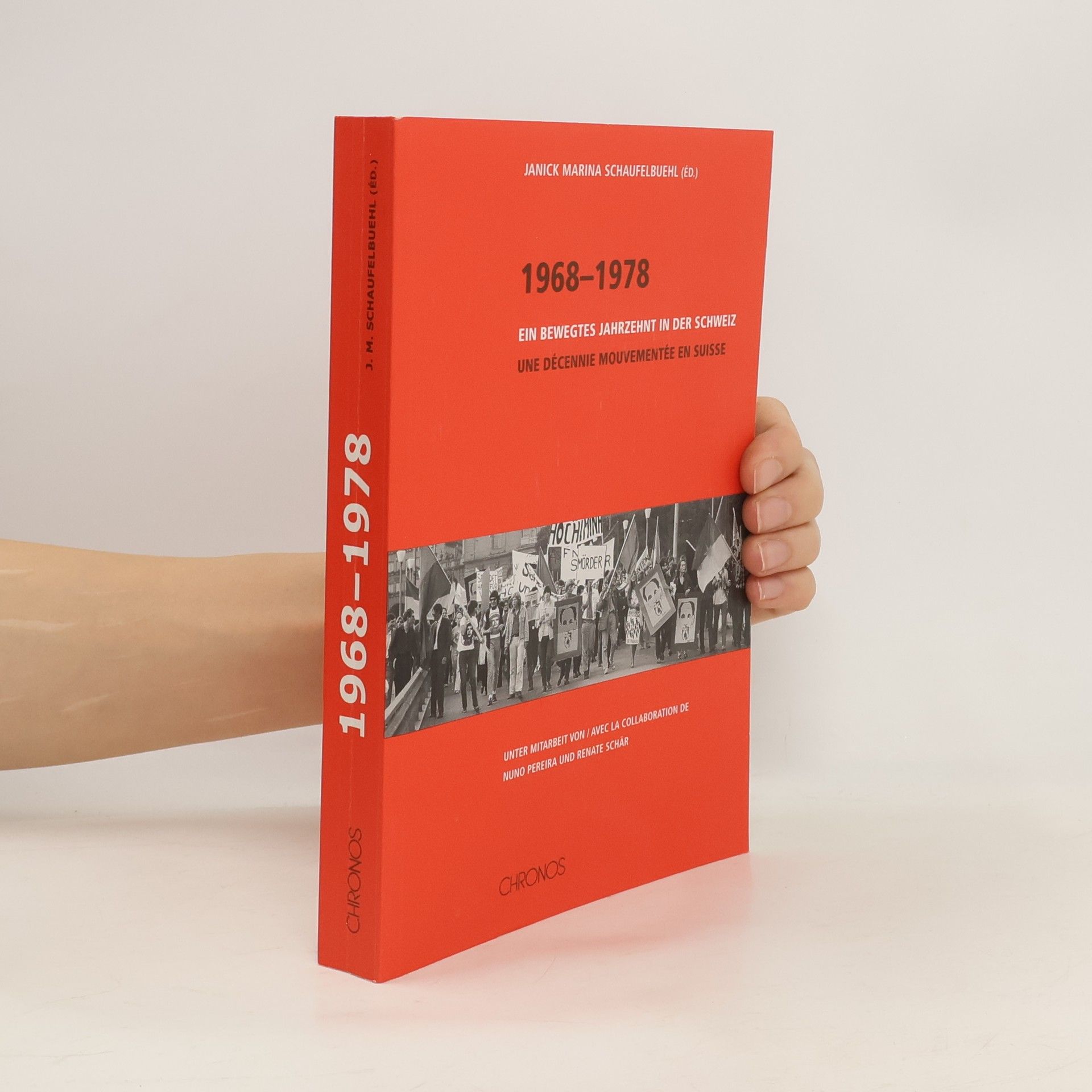Ein bewegtes Jahrzehnt in der Schweiz 1968 - 1978
- 333pages
- 12 heures de lecture
Entgegen einem weit verbreiteten Vorurteil hat es sehr wohl ein 68 in der Schweiz gegeben. Zwischen 1968 und 1978 erlebte die Schweiz ein Jahrzehnt bedeutender sozialer, politischer und kultureller Umbrüche und war Teil der weltweiten Protestwelle. Dieser Band untersucht die politische und soziale Geschichte dieser Jahre erstmals systematisch und über einen lokalen Fokus hinaus. Eine umfassende Einleitung und ein ausführlicher Schlussartikel bieten den ereignisgeschichtlichen und theoretischen Rahmen für innovative Studien zur neuen Frauenbewegung, zur internationalen Solidarität mit Vietnam oder Portugal und zu verschiedenen Ausdrucksformen der Gegenkultur, wie dem neuen Schweizer Film oder Aussteigerkommunen. In diesem Kontext wird die Entwicklung und der Einfluss dieser Bewegungen auf die Gesellschaft sowie die Wechselwirkungen zwischen lokalen und globalen Protesten beleuchtet. Die Analyse zeigt, wie die Schweiz Teil eines größeren sozialen Wandels war und welche nachhaltigen Auswirkungen diese Jahre auf die politische Landschaft und das kulturelle Leben des Landes hatten. Die Beiträge bieten neue Perspektiven auf die Dynamiken der 68er-Bewegung und deren Relevanz für die heutige Zeit.