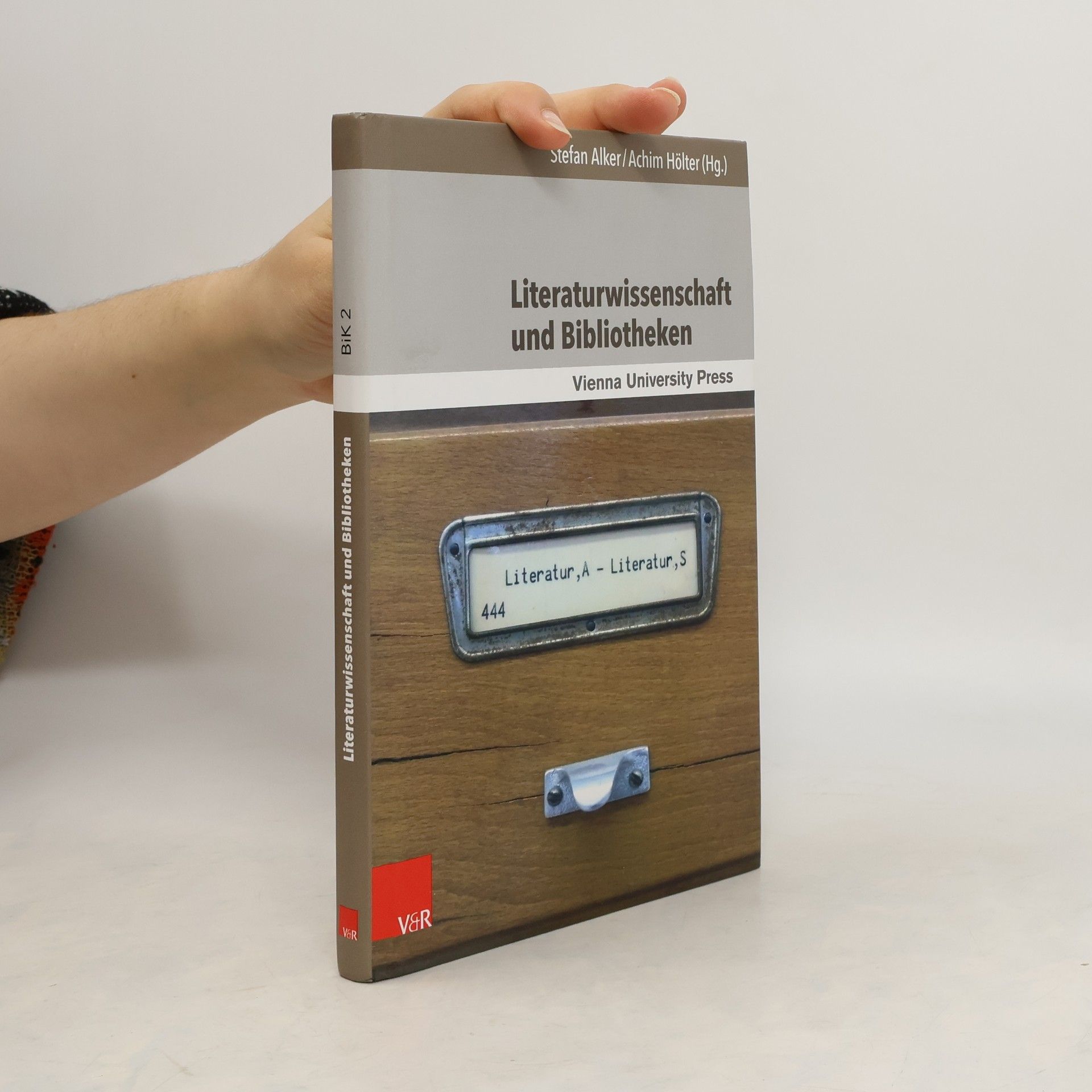Bibliotheken in der NS-Zeit
Provenienzforschung und Bibliotheksgeschichte
- 349pages
- 13 heures de lecture
Das Schicksal von in der NS-Zeit entzogenem Kulturgut ist seit den 1990er Jahren verstärkt Gegenstand von Provenienzforschung. Dieser Band vereint neueste Erkenntnisse der Provenienzforschung in Bibliotheken und liefert Beiträge zur Bibliotheksgeschichte in der NS-Zeit.Über Provenienzforschung wird in die Medien fast nur berichtet, wenn sie wertvolle Kunstobjekte betrifft. Bei Büchern ist sie relativ schwierig: Meist geht es um Massenware ohne großen materiellen Wert und die Bücher sind oft nach schwer nachweisbaren Odysseen an ihre Standorte gelangt. Dennoch setzen sich immer mehr Bibliotheken mit ihrer NS-Vergangenheit auseinander. Der Bibliothekshistoriker Jürgen Babendreier bringt es auf den Punkt: »In den geraubten Büchern wirkt Geschichte nach, lebt unsichtbar Erinnerung fort, wird historische Verantwortung präsent.«