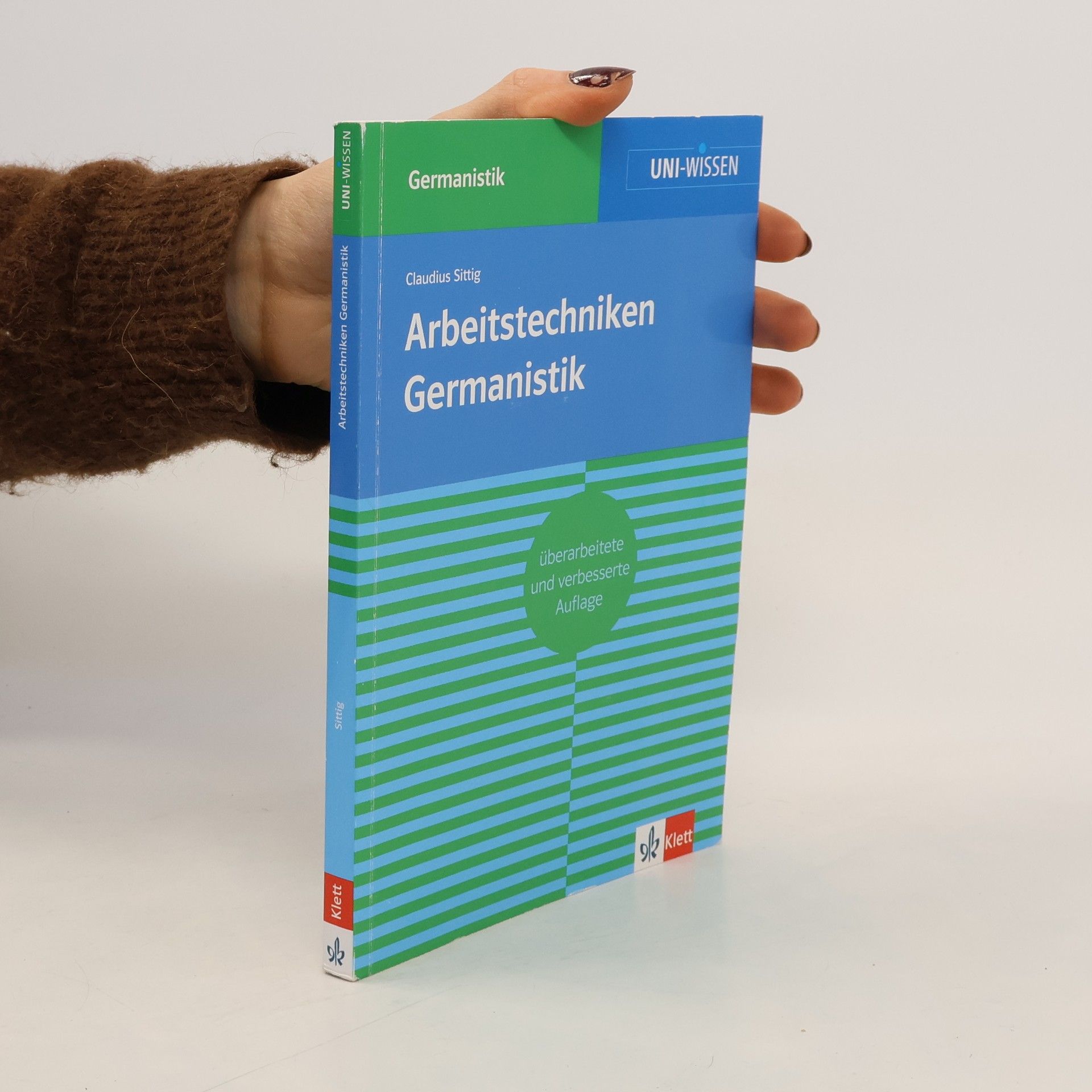Kulturelle Konkurrenzen
Studien zu Semiotik und Ästhetik adeligen Wetteifers um 1600
- 366pages
- 13 heures de lecture
Die Studie untersucht die symbolischen Rivalitäten unter Adligen um 1600 und deren kulturelle Bedeutung. Der erste Teil analysiert die Funktionen von 'Kultur', während der zweite Teil die Rolle von 'Konkurrenz' in der Adelskultur beleuchtet. Im Fokus steht Landgraf Moritz von Hessen-Kassel und verschiedene Aspekte der höfischen Pracht und Wettkämpfe.