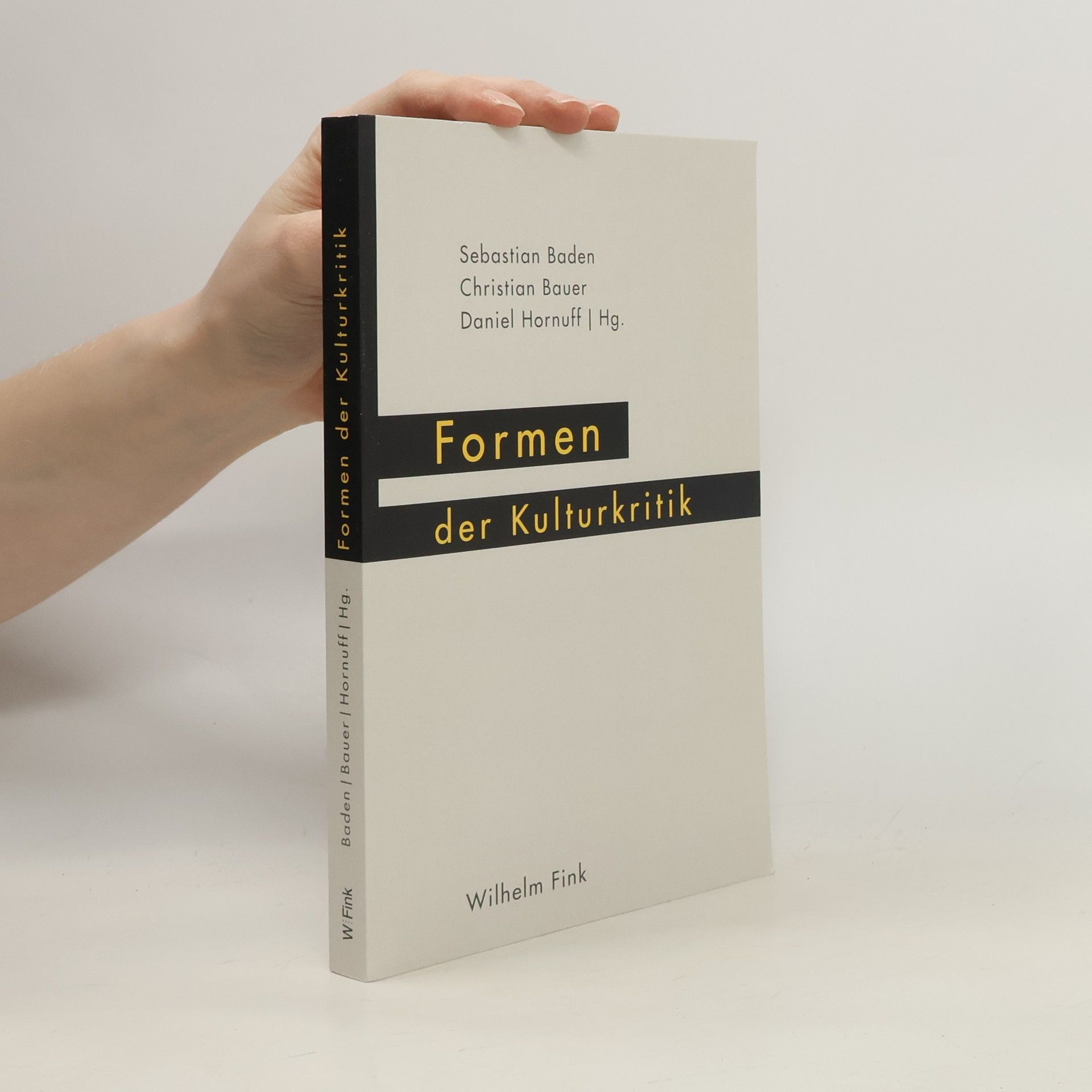MINDBOMBS
Visuelle Kulturen politischer Gewalt | Visual Cultures of Political Violence
On political violence and visual culture This catalog considers the history and political iconography of modern terrorism, focusing on the influence of terrorism on visual culture. Some of the terrorist organizations considered include the Red Army Faction (RAF), ISIS and the National Socialist Underground (NSU). Divided into three sections, this revelatory publication provides the first comparative examination of social revolutionary, far-right and jihadist terrorism. Twenty years after September 11, and ten years after the discovery of the NSU in the fall of 2011, Mindbombs explores the question of how acts of political violence affect cultural memory through the media. Artists include: Hiba Al Ansari, Khalid Albaih, Morehshin Allahyari, Francis Alÿs, Kader Attia, Walter Dahn, Jacques-Louis David, Jirí Georg Dokoupil, Christoph Draeger, Hans-Peter Feldmann, Forensic Architecture, Chloé Galibert-Laîné, Gregory Green, Johan Grimonprez, Richard Hamilton, Omar Imam, Christof Kohlhöfer, Susanne Kriemann, Jean-Jaques Lebel, Kevin B. Lee, Almut Linde, Georg Lutz, Édouard Manet, Paula Markert, Olaf Metzel, Henrike Naumann, Wolf Pehlke, Ariel Reichman, Gerhard Richter, Thomas Ruff, Ivana Spinelli, Klaus Staeck and Johann Michael Voltz.