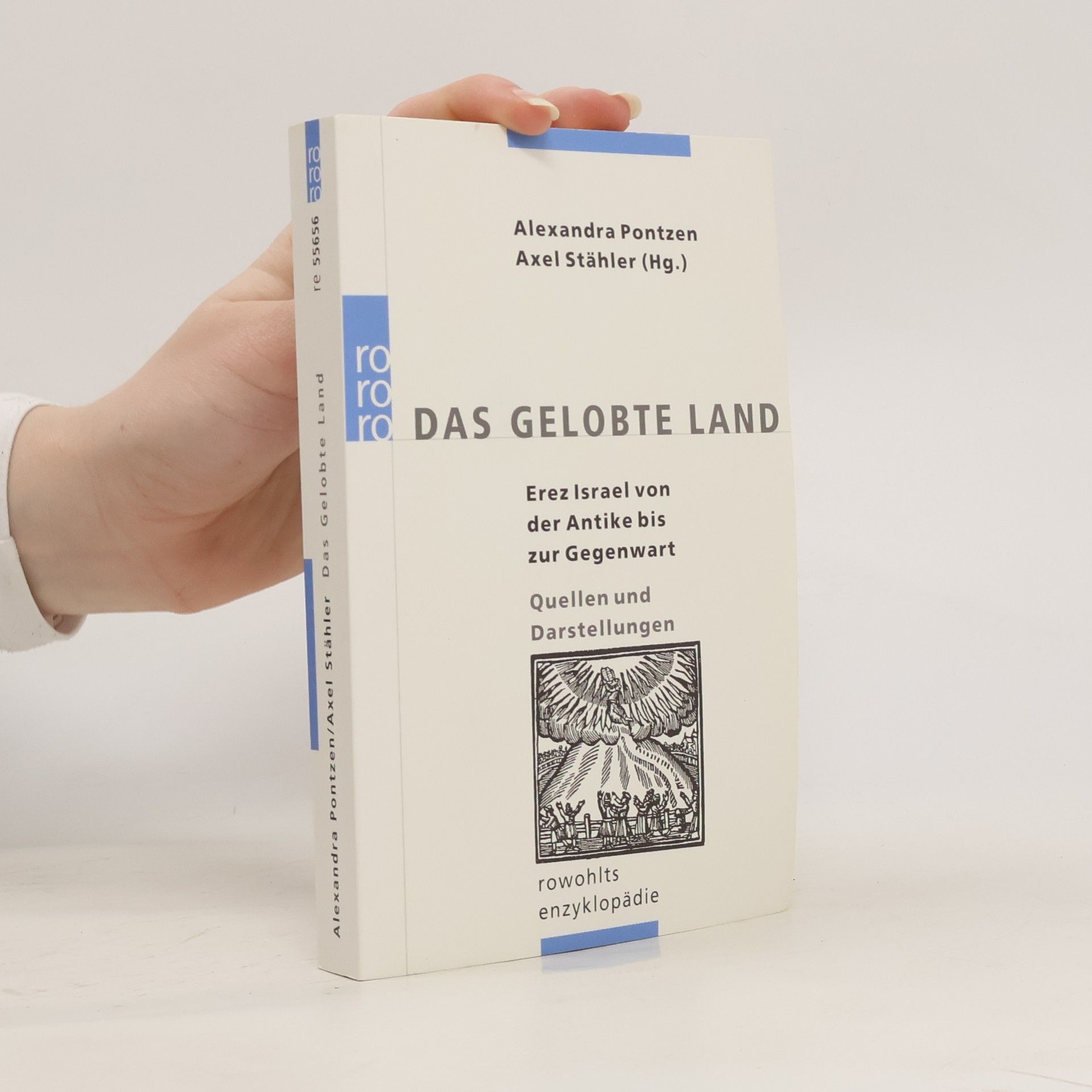Schuld und Scham
- 265pages
- 10 heures de lecture
Aias, der herausragende griechische Held vor Troia, bringt im Zustand der Raserei Herdenvieh um, da er seine Gegner zu erkennen glaubt. Als er zur Besinnung kommt, stürzt er sich aus Scham über den Ehrverlust in sein Schwert. Diese 'Entschuldigung', die für Aias nur durch den Tod möglich war, spiegelt heute den medial inszenierten Rückzug aus der politischen Öffentlichkeit oder das Eingeständnis von Fehlern wider. Es bleibt ein kollektives Bedürfnis nach solchen symbolischen Reinigungsritualen. Obwohl Anlässe und Reaktionen sich gewandelt haben, ist das Gefühl der Scham nach wie vor von existenzieller Bedeutung und hat öffentliche Symbolik. Historisch spannt sich der Bogen von der 'gewissenlosen' griechischen Antike bis zur 'unverschämten' Gegenwart. Unterschiedliche Kulturkreise konfrontieren sich in ihren Definitionen und Kompensationen von Fehlverhalten, vom paganen Griechentum über das christliche Abendland bis hin zum Islam. Im 20. und 21. Jahrhundert prägen Diskurse der Bewältigung den Umgang mit Geschichte, Kriegsschuld und Völkermord. Kulturelle, nationale, historische und gender-spezifische Unterschiede beeinflussen öffentliche und private Verhaltensweisen sowie Körpersprache. Während Schamdiskurse dazu dienen, eigenes Fehlverhalten zu regulieren, fungieren Schuldzuschreibungen und gezielte Beschämungen als Herrschaftsinstrumente, wie etwa in den Bildern von Abu Ghraib.