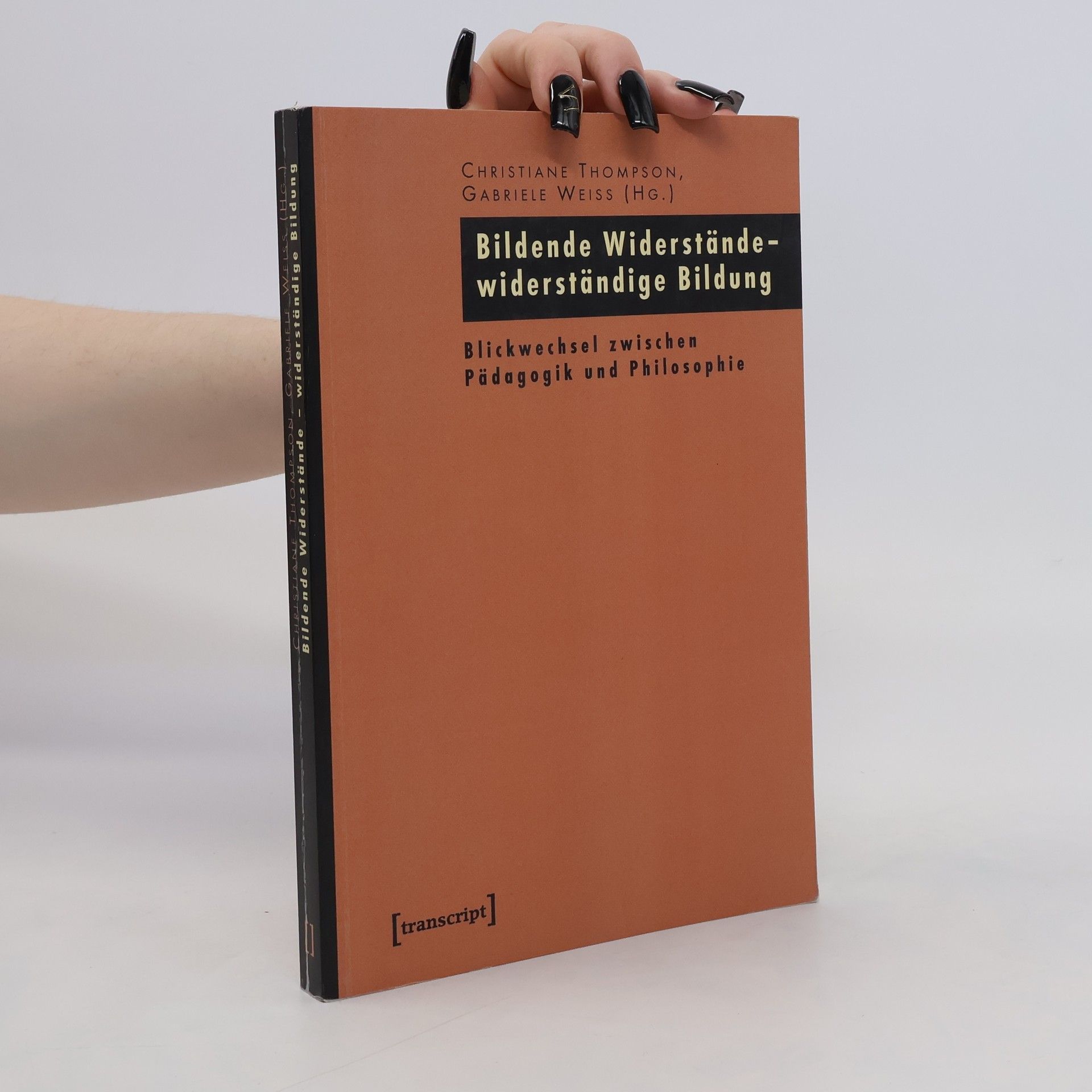Addressing Inequality - Erziehungs- und sozialwissenschaftliche Beiträge zur Subjektivierungsforschung
- 209pages
- 8 heures de lecture
Die Subjektivierungsforschung spielt eine bedeutende Rolle in der Erziehungswissenschaft und angrenzenden Disziplinen. Der Band vereint theoretische und methodologische Beiträge, die verschiedene Dimensionen sozialer Ungleichheit beleuchten und miteinander verknüpfen. Die Beiträge diskutieren zentrale Konzepte wie Ent/Subjektivierung und Handlungsfähigkeit und thematisieren Rassismus sowie Postkolonialität als subjektivierende Rahmenbedingungen. Dies ermöglicht differenzierte Einblicke in die Subjektivierungsforschung und deren Relevanz für die Analyse sozialer Ungleichheit. Das Inhaltsverzeichnis umfasst eine Einführung in die Forschungsperspektiven, gefolgt von grundlegenden Auseinandersetzungen mit der Subjektivierungsforschung, die gesellschaftliche Verhältnisse und deren kritische Betrachtung thematisieren. Weitere Analysen bieten einen rassismuskritischen Ansatz zur Kant-Rezeption und diskutieren die Un/Möglichkeit des Schwarzen Subjekts im Kontext von Judith Butlers Theorien. Zusätzlich werden theoretische Perspektiven auf Staat und negative Subjektivierung sowie die Rolle von Autorisierung und Anerkennung behandelt. Der Band schließt mit Überlegungen zur Positionalität in der Subjektivierungsforschung aus post/dekolonial-feministischer Sicht, was zu einer umfassenden Reflexion über die Herausforderungen und Chancen in der Bildungsforschung beiträgt.