Das neue Kinder- und Jugendstärkungsgesetz - KJSG
- 250pages
- 9 heures de lecture
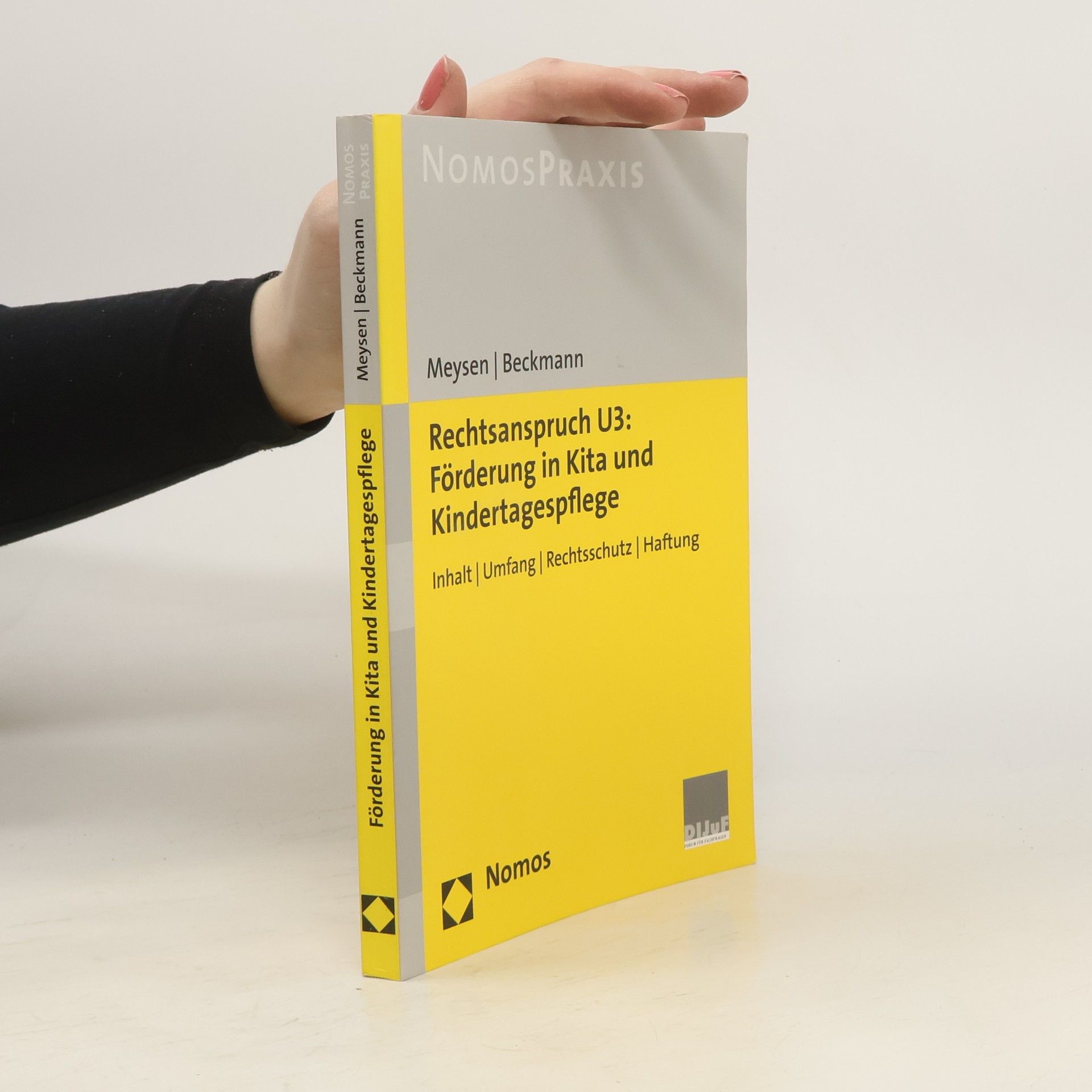

Seit August 2013 haben alle Kinder im Alter von unter drei Jahren einen Rechtsanspruch auf Förderung in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege. Der Band gibt allen mit der Jugendhilfe Befassten konkrete Antworten, wie der Rechtsanspruch U3 umzusetzen ist. Die praktischen Fragen sind Legion, z. B.: Welchen zeitlichen Umfang an täglicher Förderung können Kinder beanspruchen, deren Eltern nicht erwerbstätig sind? Kann eine Förderung auch in atypischen Zeiten verlangt werden (Morgen-, Abend- oder Nachtstunden, Wochenende)? Wie weit geht das Wunsch- und Wahlrecht der Leistungsberechtigten? Welcher Schaden, den Erziehungsberechtigte infolge eines fehlenden oder nicht gewährten Platzes erleiden, muss ersetzt werden? Wann kommt ein Haftungsausschluss in Betracht? Das Buch gibt konkrete Antworten für Jugendämter, freie Träger, Kommunen sowie Eltern und ihre Kinder. Nicht nur der Inhalt des „Rechtsanspruchs U3“, sein Umfang und seine Grenzen werden umfassend und leicht zugänglich aufbereitet; auch Klagemöglichkeiten und Haftungsansprüche sowie landesrechtliche Besonderheiten werden berücksichtigt.