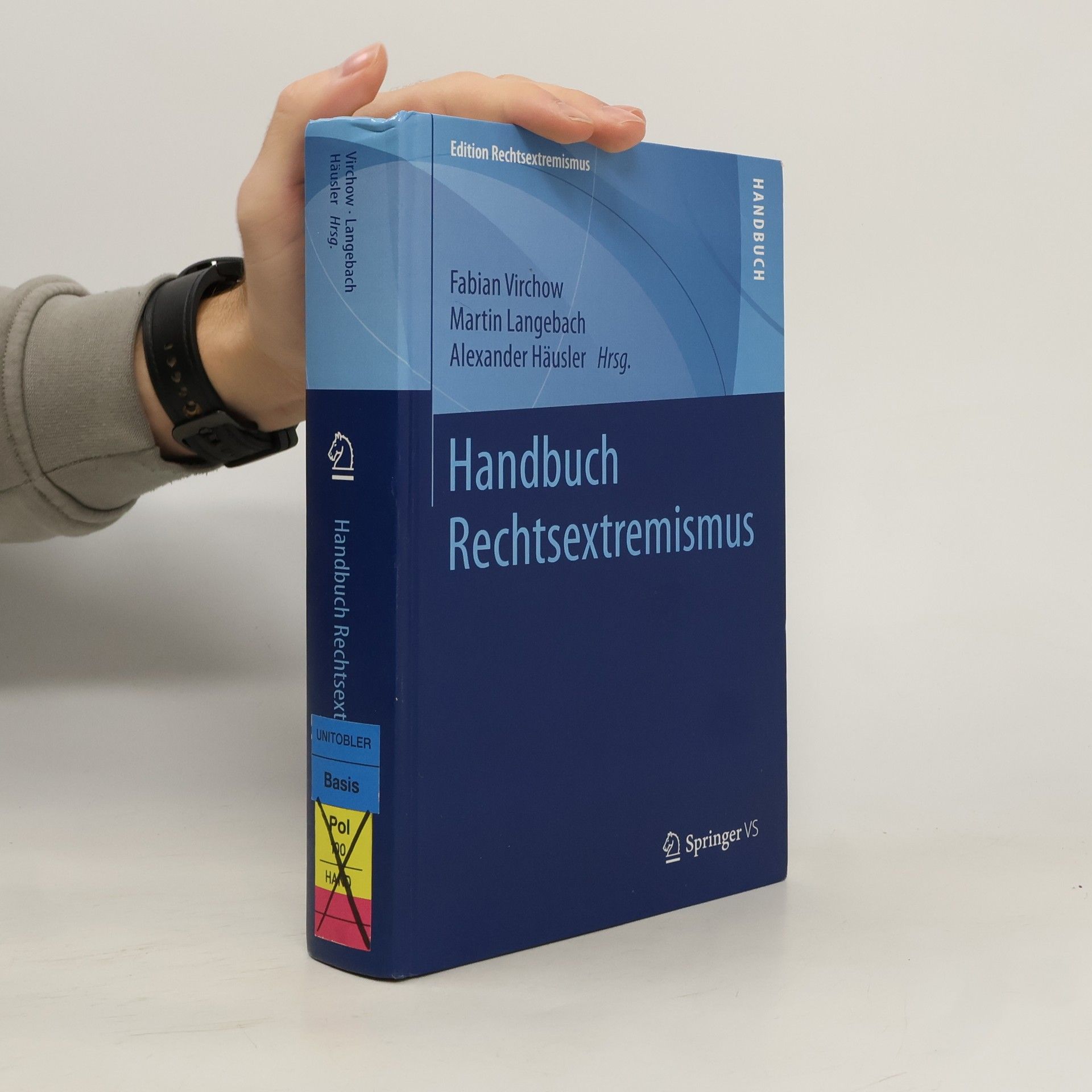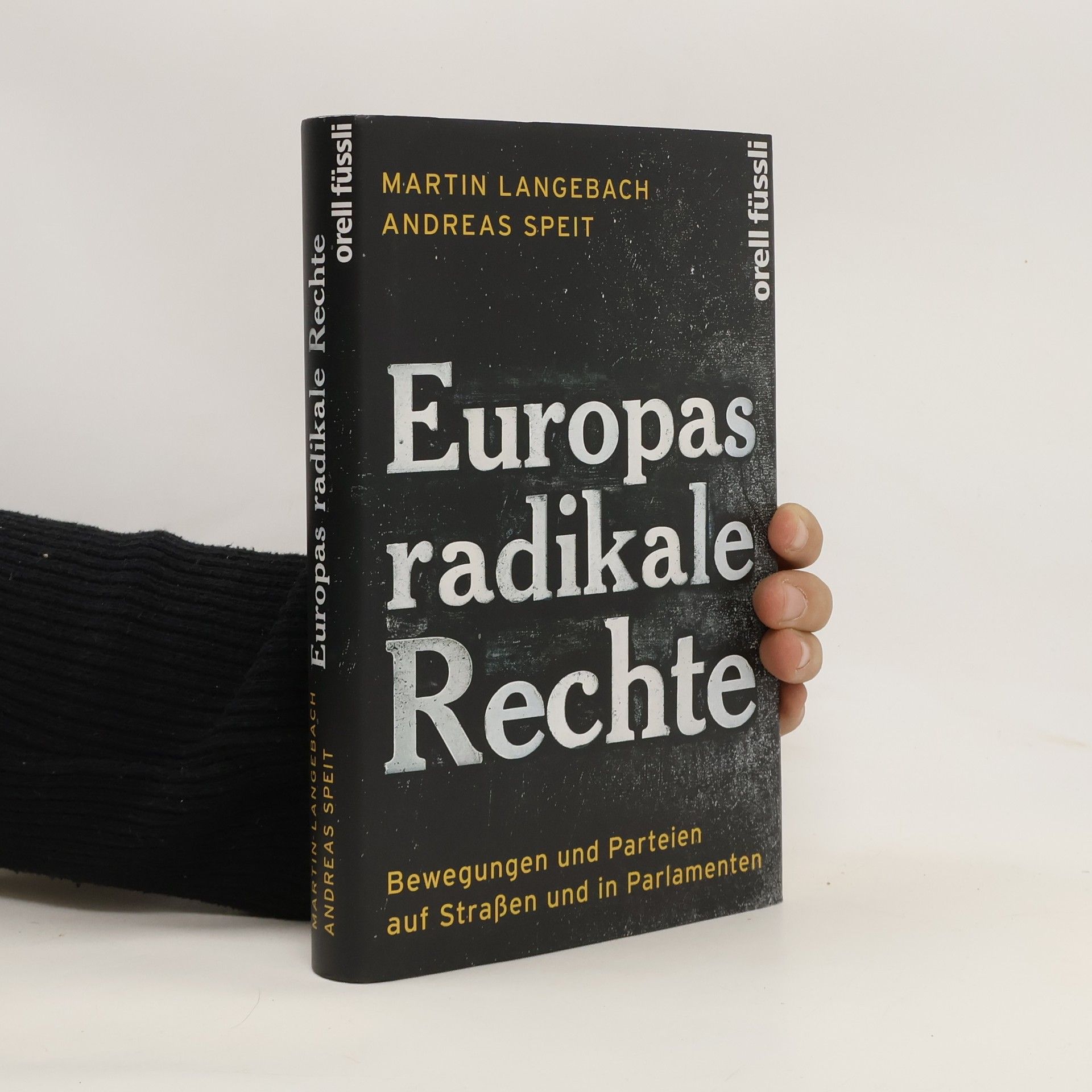Erinnerungsorte der extremen Rechten
- 304pages
- 11 heures de lecture
Geschichtspolitik ist für die extreme Rechte von zentraler Bedeutung. Das spiegelt sich in ihren Publikationen ebenso wie bei ihren Aufmärschen mit historischen Bezügen. Das kollektive Gedächtnis der extremen Rechten ist durch ein Repertoire an Mythen, Bildern und Erzählungen geprägt, die in Anlehnung an Pierre Nora als „Erinnerungsorte“ begriffen werden können. Diese beziehen sich nicht nur auf geografische Orte, sondern auch auf Ereignisse, Artefakte oder Ideen. Erinnerungsorte erfüllen für dieses politische Spektrum eine wichtige sinnstiftende Funktion: Sie sollen dessen nationalistische und ethnozentrisch-rassistische Gemeinschaftsentwürfe legitimieren. Quellennah skizzieren die Autorinnen und Autoren ausgewählte Erinnerungsorte, analysieren deren symbolische Aufladung, dekonstruieren die daran geknüpften Mythen und fragen nach der strategischen Bedeutung für extrem rechte Politikkonzepte.