Die hier versammelten Glossen erkunden mit philosophischem Spursinn den Zeitgeist und gehen der Frage nach, was die Aufgabe philosophischen Denkens in der Gegenwart sein kann. Einen Ausgangspunkt bildet die Beobachtung, dass das Bedurfnis nach Selbstvergewisserung und Weltdeutung in Zeiten beschleunigten gesellschaftlichen Wandels in steigender Taktzahl Zeitdiagnosen hervorbringt; immer neue So-und-so-Generationen und So-und-so-Gesellschaften werden in immer kurzer werdenden Abstanden ausgerufen. Die thematischen Brennpunkte der Texte sind das Spektrum reicht von der Psychopathologie des Alltagslebens bis zur Transparenz-Idee, vom Hass bis zur Liebe.
Uwe Justus Wenzel Livres
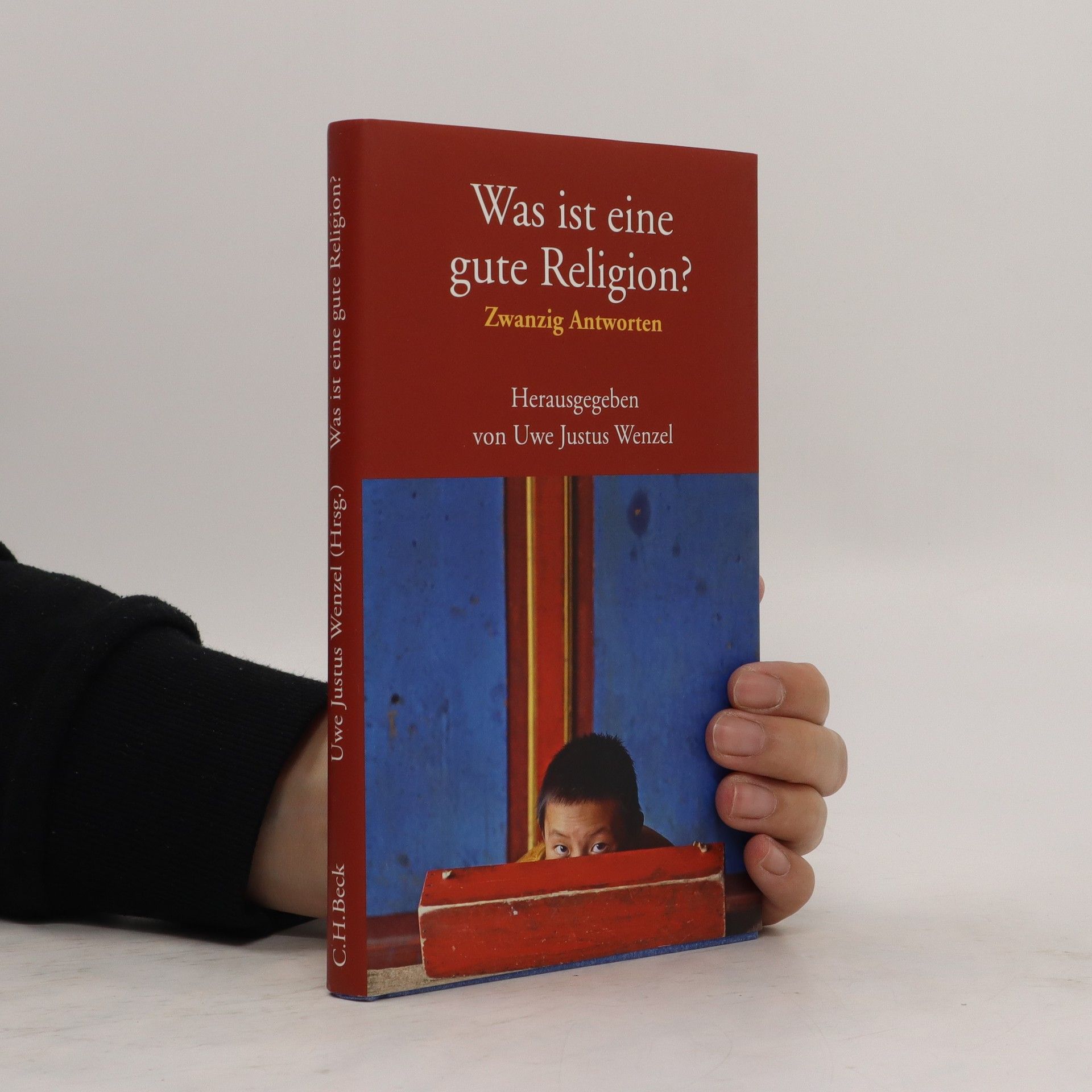

Was ist eine gute Religion?
Zwanzig Antworten
Was ist eine gute Religion? Religion ist ideologieanfällig. Aber sie ist nicht dasselbe wie Ideologie. Sie muß nicht fundamentalistisch werden, sie kann es. Was ist eine „gute“, was eine „schlechte“ Religion? Dieser Frage gehen achtzehn Autoren nach, die sich seit längerer Zeit denkend - und teilweise auch ganz praktisch - mit religiösem Glauben beschäftigen. Die Religionen haben uns in letzter Zeit wieder das Fürchten gelehrt. Sie können unduldsam, fanatisch, selbstherrlich, streitsüchtig und gewalttätig werden. Aber Religionen müssen nicht „schlecht“ sein. Ein und dieselbe Religion kann Gewalt predigen und für ein friedliches Miteinander eintreten. Wann ist eine Religion gut - gut für die Gläubigen und für die anderen? Ganz unterschiedliche Autoren - Theologen, Philosophen, Religionswissenschaftler, Psychologen, Soziologen und Schriftsteller - gehen dieser Frage nach. Sie alle eint die Überzeugung, daß keine Religion gut genannt werden kann, die das freie Nachdenken über gute und schlechte Religion verbietet. Mit Beiträgen von: Karen Armstrong, Jan Assmann, Michael von Brück, Friedrich Wilhelm Graf, Arno Gruen, Susanne Heine, Bischof Wolfgang Huber, Navid Kermani, Karl Kardinal Lehmann, Mark Lilla, Hermann Lübbe, Paul Mendes-Flohr, Chakravarthi Ram-Prasad, Gerhard Schulze, Robert Spaemann, Jochen Teuffel, Michael Theunissen, Christoph Türcke, Uwe Justus Wenzel