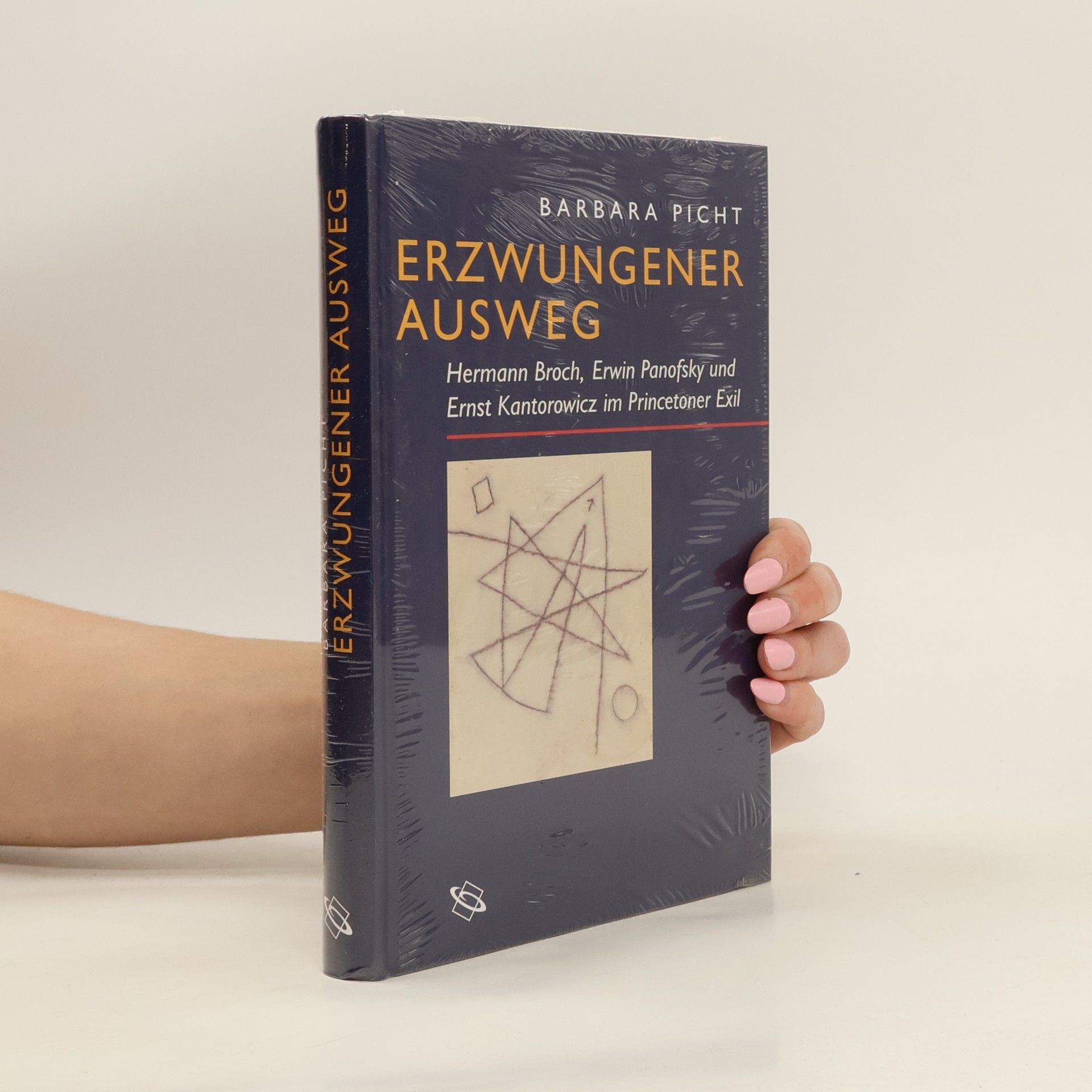Die »Interpreten Europas« und der Kalte Krieg
Zeitdeutungen in den französischen, deutschen und polnischen Geschichts- und Literaturwissenschaften
- 336pages
- 12 heures de lecture
Die Metapher vom Eisernen Vorhang beherrscht unsere Wahrnehmung des Kalten Kriegs bis heute. Doch welchen Einfluss hatte die Trennung zwischen Ost und West auf die sozial- und kulturhistorische Selbsterforschung Europas in der zeitgenössischen Geschichts- und Literaturwissenschaft? Barbara Picht macht das Ost-West-Paradigma selbst zum Untersuchungsgegenstand der Wissenschaftsgeschichte, anstatt es zu übernehmen. Sie analysiert signifikante kulturelle Selbstentwürfe im Europa des Kalten Krieges mit einem Schwerpunkt auf Geschichte und Literatur. Am Beispiel des Werkes von Fernand Braudel und Robert Minder (Frankreich), Werner Conze und Ernst Robert Curtius (BRD), Walter Markov und Werner Krauss (DDR) und Oskar Halecki und Czesław Miłosz (Polen bzw. US-amerikanisches Exil) zeigt sie, dass die "Interpreten Europas" der bipolaren Logik der Systemkonfrontation nicht gehorchten. Die "institutionelle Macht" des Kalten Krieges war sehr wohl zu spüren, doch vom beherrschenden Bild des iron curtain muss man sich lösen, geht es um die Geschichte der europäischen Geistes- und Kulturwissenschaften im Systemkonflikt