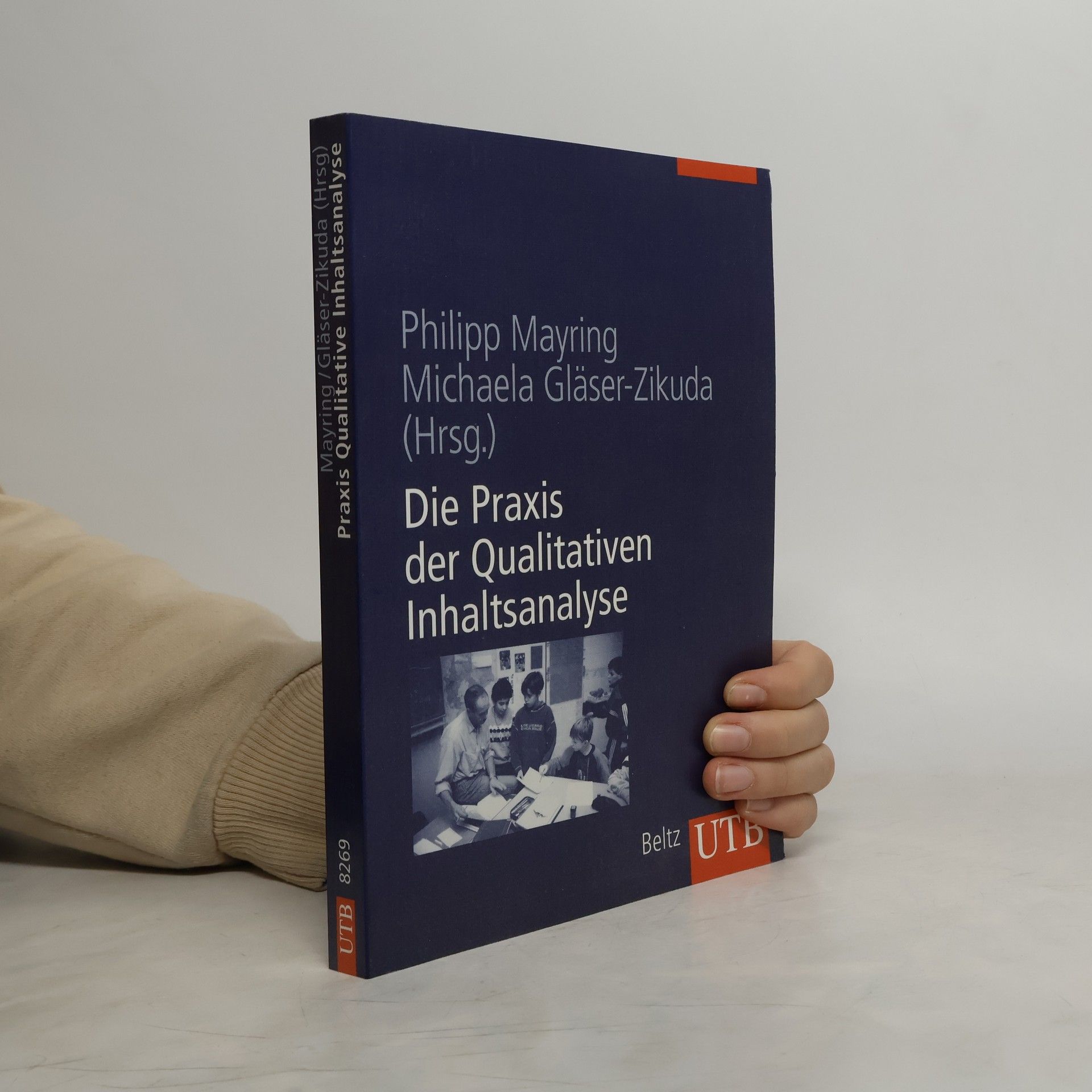Emotionen im Unterricht
Psychologische, pädagogische und fachdidaktische Perspektiven
Emotionen sind ausschlaggebend für den Erfolg von Lehr- und Lernprozessen. Ob Kinder gerne in die Schule gehen oder nicht, hängt wesentlich davon ab, ob sie im Unterricht und im Umgang mit Lehrkräften und Mitschüler*innen eher Freude und Stolz oder Ärger und Angst verspüren. Die einzelnen Beiträge des Bandes beleuchten Emotionen von Lernenden und Lehrenden aus erziehungsphilosophischer, bildungstheoretischer, pädagogischer, psychologischer und fachdidaktischer Perspektive. Theoretische und empirische Zugänge werden gleichermaßen berücksichtigt.