Schuld ist zentral für freie Gesellschaften und basiert auf individueller Autonomie. Sie reflektiert Normverletzungen und wird in rechtlichen, moralischen und religiösen Kontexten unterschiedlich interpretiert. Moderne Gesellschaften versuchen, diese Diversität mit den Rollen der Akteure zu harmonisieren und erweitern das Schuldverständnis durch Verantwortung und Folgenabschätzung.
Benno Zabel Livres
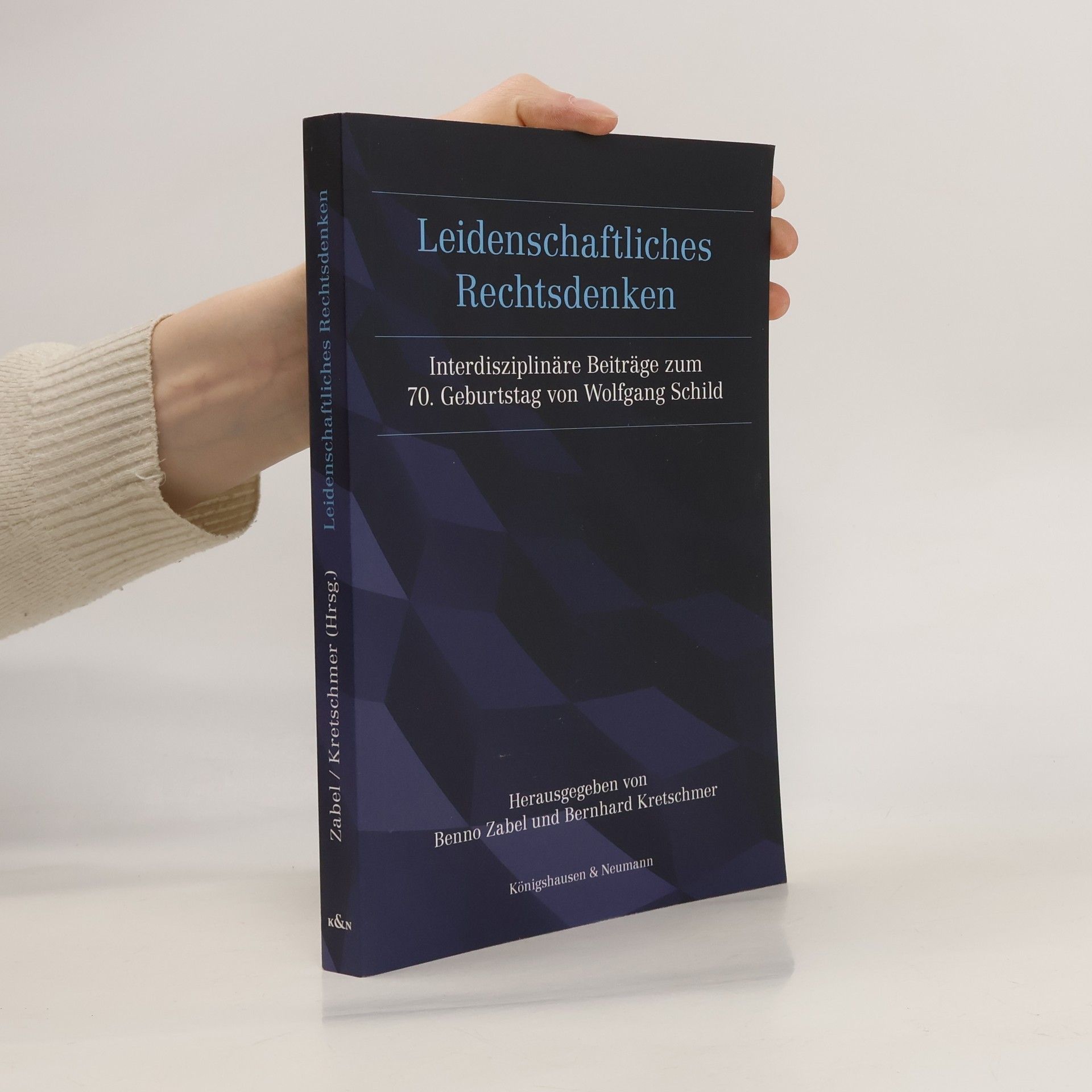

W. Behringer: Clipeus adversus haeresim? Zur Wechselwirkung von Dämonologie und Gesetzgebung im Lichte der jüngeren Hexenforschung – G. Gebauer: Hat der Kampf gegen Doping noch einen Sinn? – W. Gropp: „[...] in Lehre und Forschung vertreten.“ Überlegungen zum Anforderungsprofil einer Universitätsprofessur für [...] – G. Kocher: Rechtsverfolgung und Körpersprache – R. Kölbel: Der Strafrichter in der Hauptverhandlung revisited: Zur Verfahrensgerechtigkeit und den Leistungen des Strafprozessrechts – B. Kretschmer: „Der Fall Collini“ (Ferdinand von Schirach). Ein Lehrstück über Rache, Krieg und skandalöses Recht? – H. Lück: Am Schnittpunkt von Strafrechtsgeschichte und Rechtsikonographie: Das Carpzov-Epitaph im Neuen Paulinum der Universität Leipzig – K. Schüttauf: Die Geburt der Freiheit aus dem Geist der Liebe. Einige Gedanken zu Beethovens „Fidelio“ – K. Seelmann: Wolfgang Schild als Rechtsphilosoph – T. Vormbaum: Meister Floh und die juristische Zeitgeschichte. Rechtshistorische Betrachtungen zu E. T. A. Hoffmanns „Mährchen in sieben Abentheuern“ – B. Zabel: Die Würde in Zeiten der Werte. Über Zweckrationalität und Freiheit.