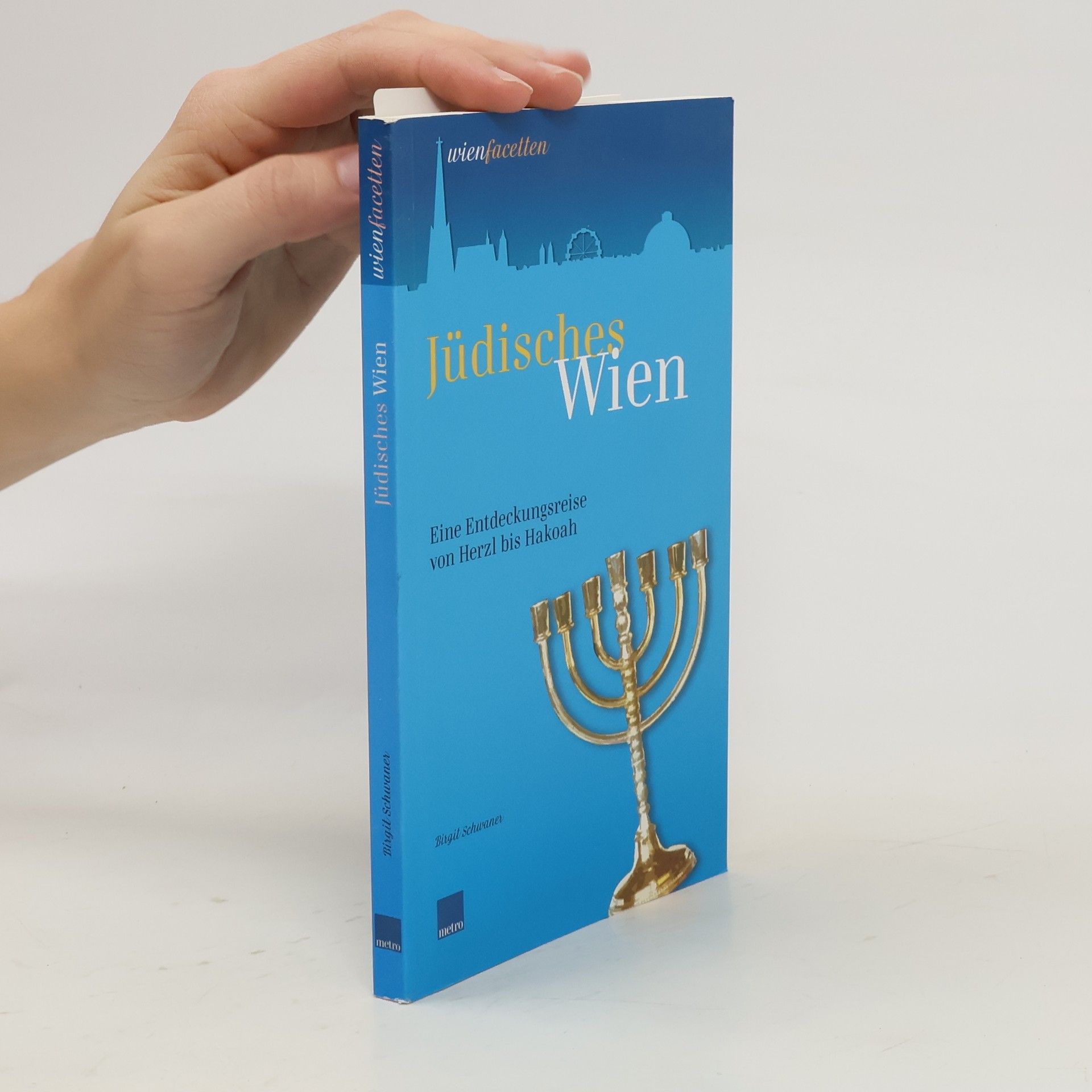Eine namenlose Stadt nach einem Krieg, eine Mauer, die die Villenviertel der Reichen schützt, hübsch gestaltete, kleine Drohnen, die, klick, klick, in den Wohnungen filmen. Produziert werden sie vom Konzern „Polyphem Corporation“, dessen einäugiger Präsident davon träumt, im Süden der Stadt einen französischen Garten anzulegen, bestückt mit Automaten aus seiner Sammlung: Gedichtgeneratoren, die aussehen wie Papageien; Maschinen, die gesprochene Sätze in Bilder umwandeln und anderes, was als Sensation gilt, wo es offiziell weder Bücher noch Künstler mehr gibt. Auf der anderen Seite der Mauer wohnen, in Häusern, Hütten und Zelten, die apathischen, oft mittellosen „Meisten“. Unter ihnen die Protagonistin „Nina“, die von einer Erzählerin durch diese düs- tere Welt geschickt wird – auf der Suche nach einem plötzlich verschwundenen Freund. In weiteren Rollen: drei mechanische Spatzen und die Sekte der Menetklisten, deren Mitglieder Mauern, Wände und Fußböden „lesen“.
Birgit Schwaner Livres



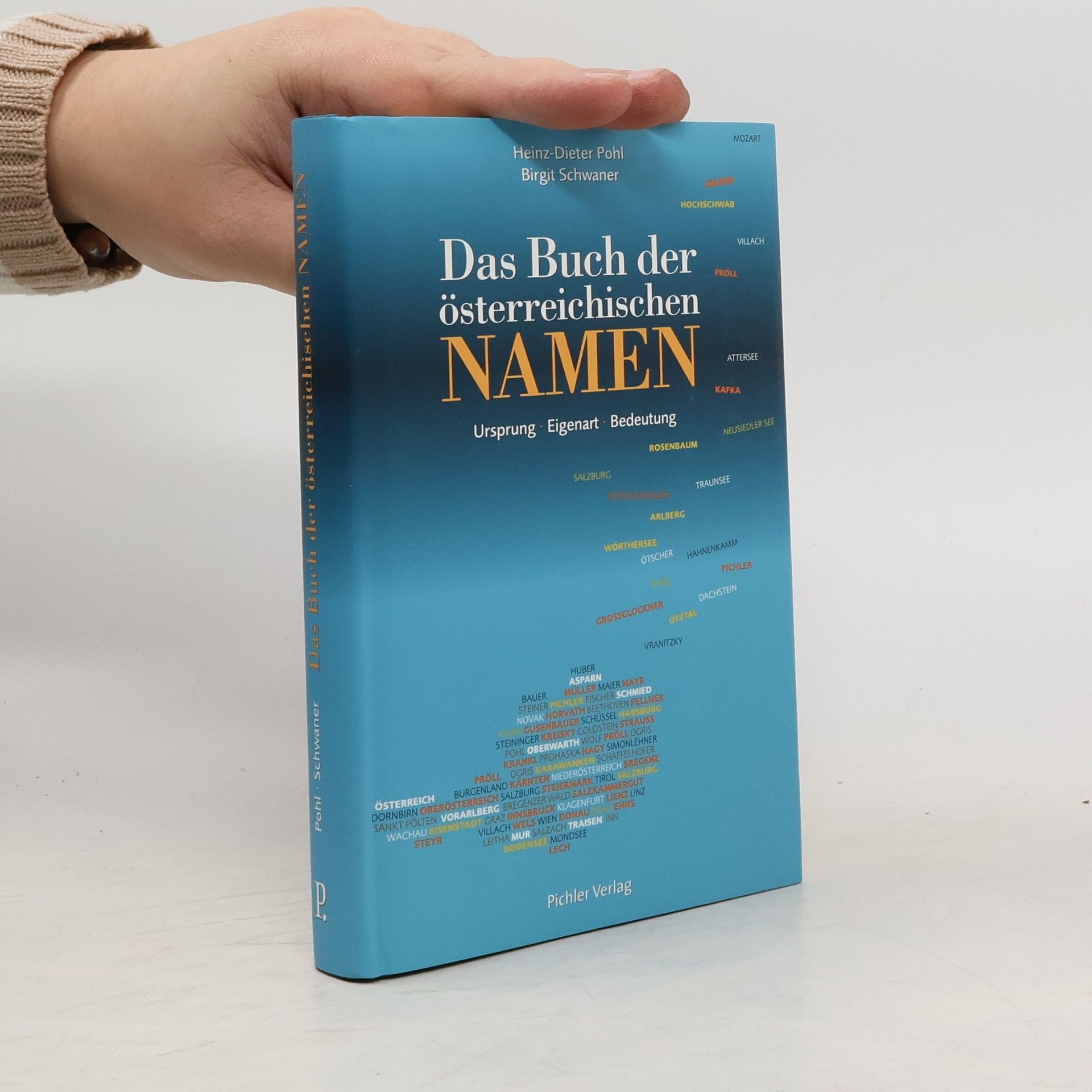
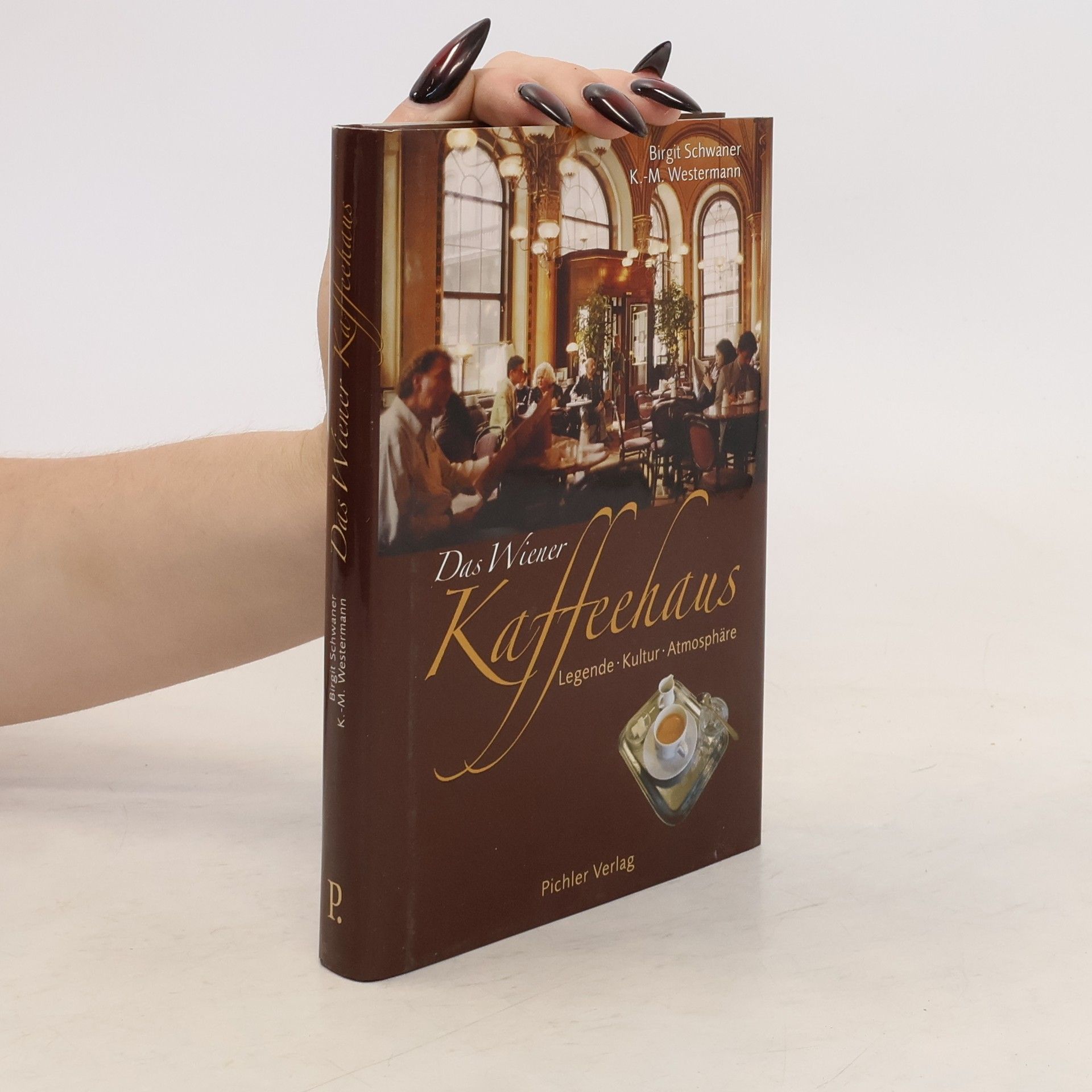
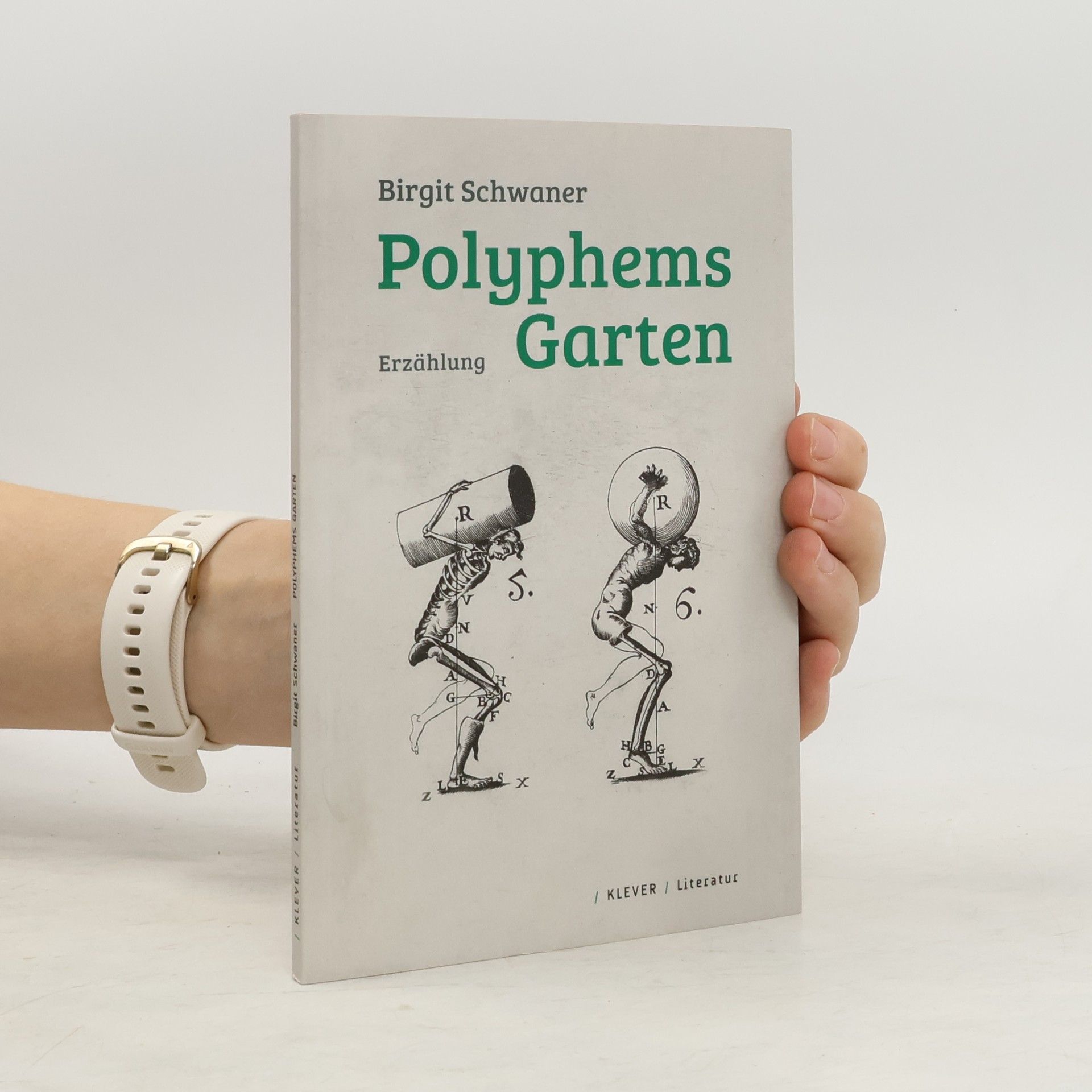
Das Buch der österreichischen Namen. Ursprung, Eigenart, Bedeutung
- 240pages
- 9 heures de lecture
Historische Bauten und Kunstwerke gelten oft als das älteste kulturelle Erbe, während die Bedeutung unserer Sprache, die solches Schaffen erst ermöglicht, oft übersehen wird. Besonders die Namen sind der älteste Bereich unserer Sprache. In Österreich stammen viele Namen, wie die der Alpen oder der Donau, aus vorrömischer Zeit und spiegeln die Spuren zahlreicher Völkerschaften wider. Diese Namen bieten Einblicke in die Kulturgeschichte und laden zu einer spannenden Reise in die Vergangenheit ein – auch in die eigene Familiengeschichte. Der Sprachwissenschaftler Heinz Pohl führt in diesem Buch durch die Welt der Namen in Österreich. Leser erfahren Interessantes über die Herkunft und Bedeutung der Namen von Bundesländern, Städten, Gewässern, Bergen und Landschaften. Ein Kapitel widmet sich den Familiennamen, ein anderes den Nachbarn. Auch typische Traditionen und Speisen werden behandelt. Die Geschichten rund um die Entstehung der österreichischen Identität sind sowohl spannend als auch unterhaltsam. Das Buch enthüllt die faszinierenden Geheimnisse der österreichischen Namenskultur und betrachtet Namen als „Herzstücke“ der österreichischen Identität, während es den Spuren bedeutender Familien-, Berg-, Gewässer-, Städte- und Ortsnamen folgt.
Alice und ich
- 100pages
- 4 heures de lecture
Kurz vor Neujahr landet die Erzählerin dieser Aufzeichnungen im Krankenhaus. Hier begegnet sie der schillernden Künstlerin Alice – einer veritablen Namensvetterin von Lewis Carrolls „Alice in Wonderland“. Carrolls Figur Alice war 1941 von französischen Surrealisten zur Sirene des Traums ernannt worden. Nun, 84 Jahre später, während draußen der erste Tag des Jahres 2015 mit Böllern und Donauwalzer begrüßt wird, bringt Alice im Krankenzimmer eine Sirenenmaschine ins Spiel, mit deren Hilfe man sich, zumindest im Kopf, aus der bedrückenden Lage einer Patientin befreien könne. Selbst angesichts der schwerwiegenden Diagnose Eierstockkrebs, mit der sie und die Erzählerin zurechtkommen müssen. Keine Frage, ein solcher Versuch, der Spitalswirklichkeit und der Angst vor einer tödlichen Krankheit zu entfliehen, muss am Ende scheitern. Wie alles. Aber vorher wird die Kunst zur Überlebenskunst, das Schreiben zur Möglichkeit, der Realität ein Schnippchen zu schlagen.
Prinz Eugen
- 157pages
- 6 heures de lecture
Die Wittgensteins
- 159pages
- 6 heures de lecture
Die Geschichte beginnt mit Moses Meyer, einem jüdischen Gutsverwalter, der den Namen seines Wohnorts Wittgenstein annimmt. Sein Sohn zieht mit seiner Familie nach Vösendorf bei Wien. Und hier floriert das Geschäft des Kaufmanns, der, ganz Patriarch, seine Söhne in die Firma einbinden möchte. Doch der siebzehnjährige Karl reißt von zu Hause aus, schlägt sich nach Amerika durch, wo er in New York als Kellner, Barmusikant und Lehrer überlebt. Zurück in Wien beginnt er eine typische Gründerzeitkarriere und wird zu einem der erfolgreichsten Unternehmer der Donaumonarchie. Seine beiden Söhne, Paul und Ludwig, schreiben ihre eigene Geschichte. Der eine als einarmiger Pianist, der andere als einer der bedeutendsten Philosophen des 20. Jahrhunderts. Bemerkenswert sind aber auch die Frauen der Familie, wie etwa Margrethe Stonborough-Wittgenstein, die mit Freud befreundet und von Klimt porträtiert wurde. Die Autorin, Birgit Schwaner, zeichnet in dem ihr eigenen literarischen Stil ein facettenreiches Porträt dieser altösterreichischen schillernden Familie.
Jüdisches Wien
- 125pages
- 5 heures de lecture
Die jüdische Geschichte in Wien beginnt mit Schlomo, dem Münzmeister der Babenberger. Immer wieder wurden Juden als Finanzhelfer in die Stadt geholt, um später unter fadenscheinigen Vorwänden vertrieben zu werden. Ab 1625 entsteht im Unteren Werd, einem Teil der heutigen Leopoldstadt, eine florierende jüdische Gemeinde. Es dauert jedoch Jahrhunderte, bis die Gleichstellung der Juden mit den Christen erreicht wird und jüdische Intellektuelle in die Gesellschaft integriert werden. Das jüdische Großbürgertum spielt eine zentrale Rolle im kulturellen Leben der Stadt. In den Salons reicher jüdischer Familien versammeln sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts Künstler und kritische Denker, die Eleganz und Weltläufigkeit in die Stadt bringen. Das Wiener Geistesleben dieser Zeit ist untrennbar mit dem jüdischen verbunden, wie die Namen Freud, Schnitzler, Roth oder Kraus zeigen. Der Anschluss an Hitlerdeutschland 1938 führt zum Aus für 170.000 Juden. Heute leben noch 6.500 Juden in Wien, oft zurückgezogen und unter sich. Zahlreiche Orte zeugen von der Blüte und dem Niedergang des Judentums in Wien. Die Autorin verfolgt in ihren Texten diese Spuren und erzählt von der heute gelebten jüdischen Tradition, die von der Talmud-Schule bis zum koscheren Restaurant reicht.