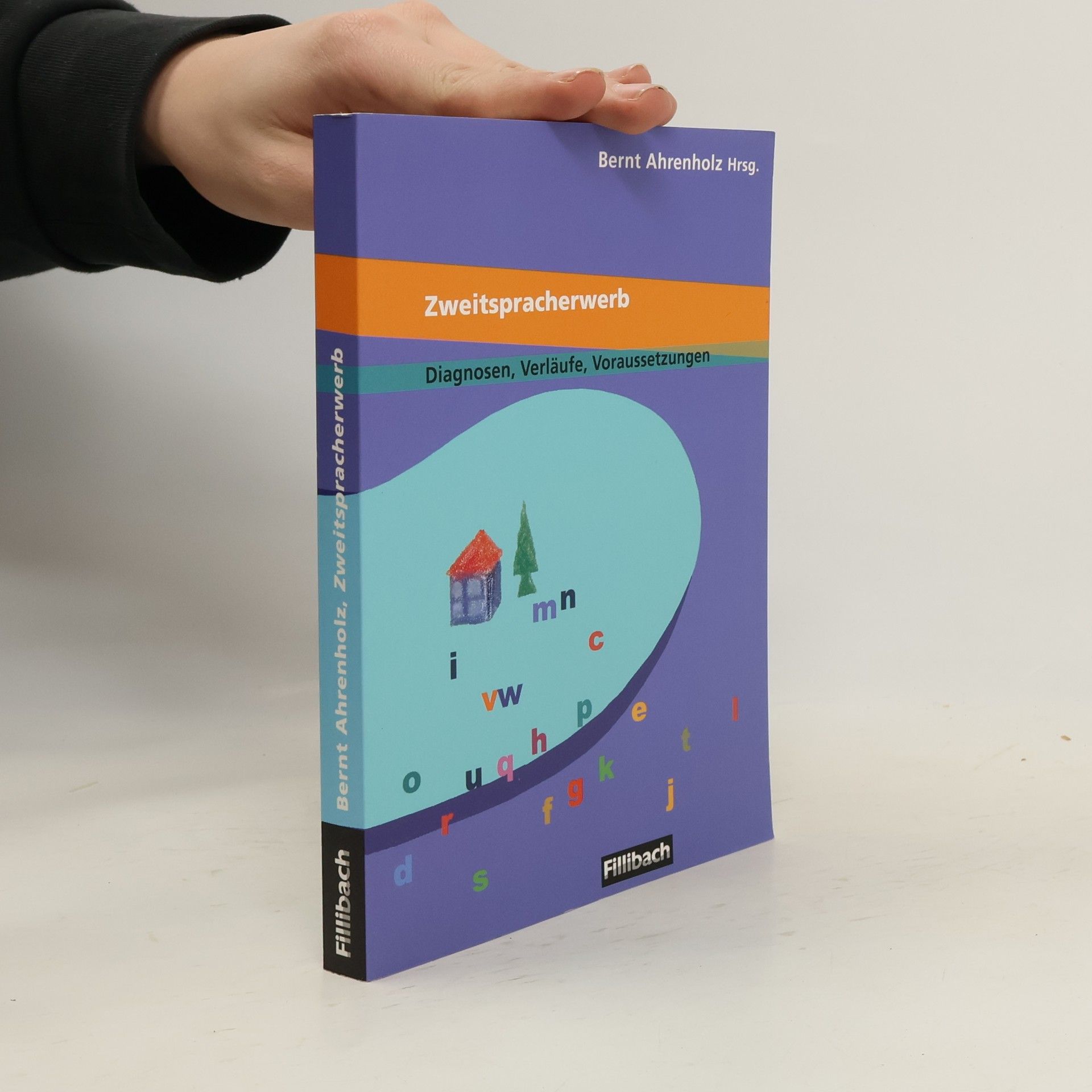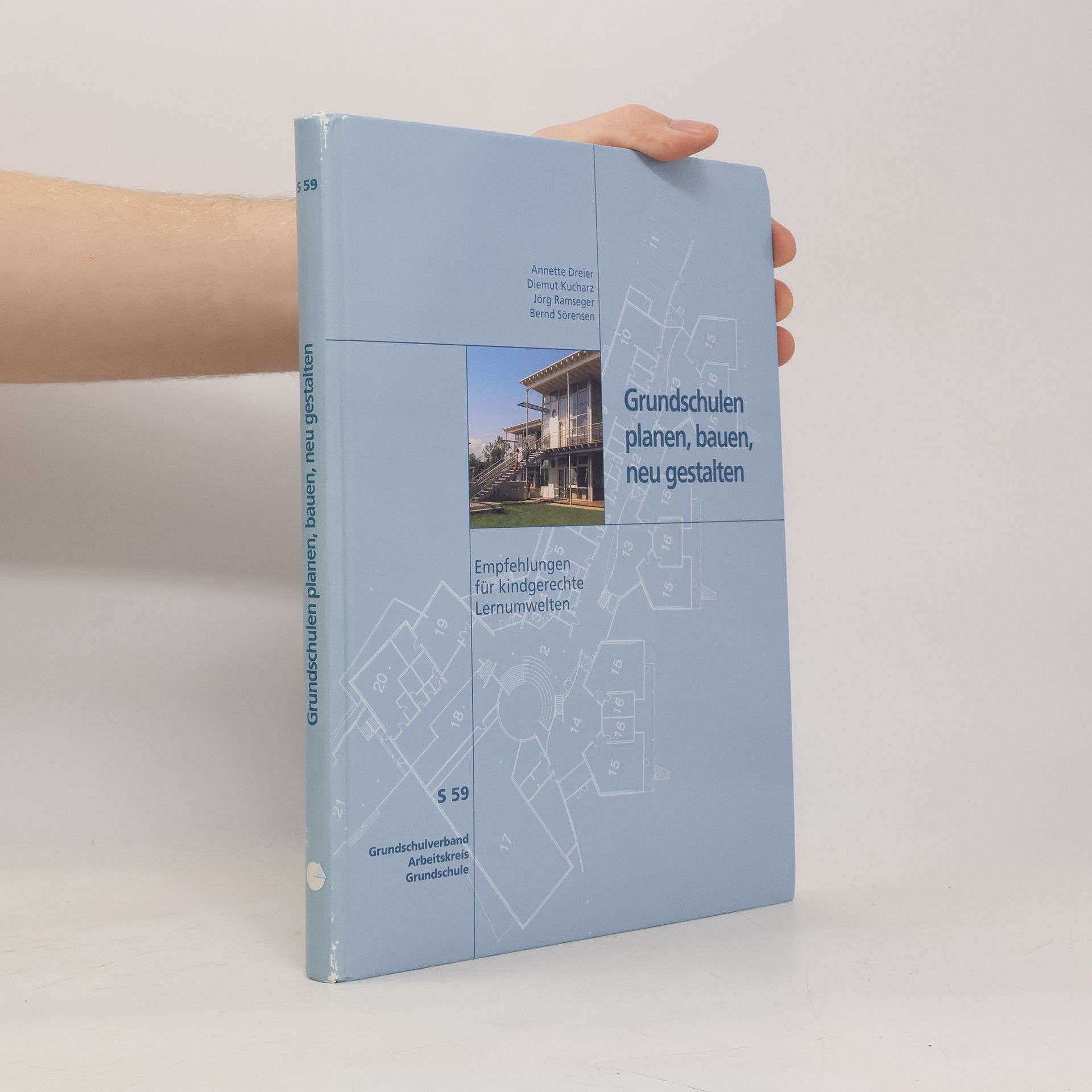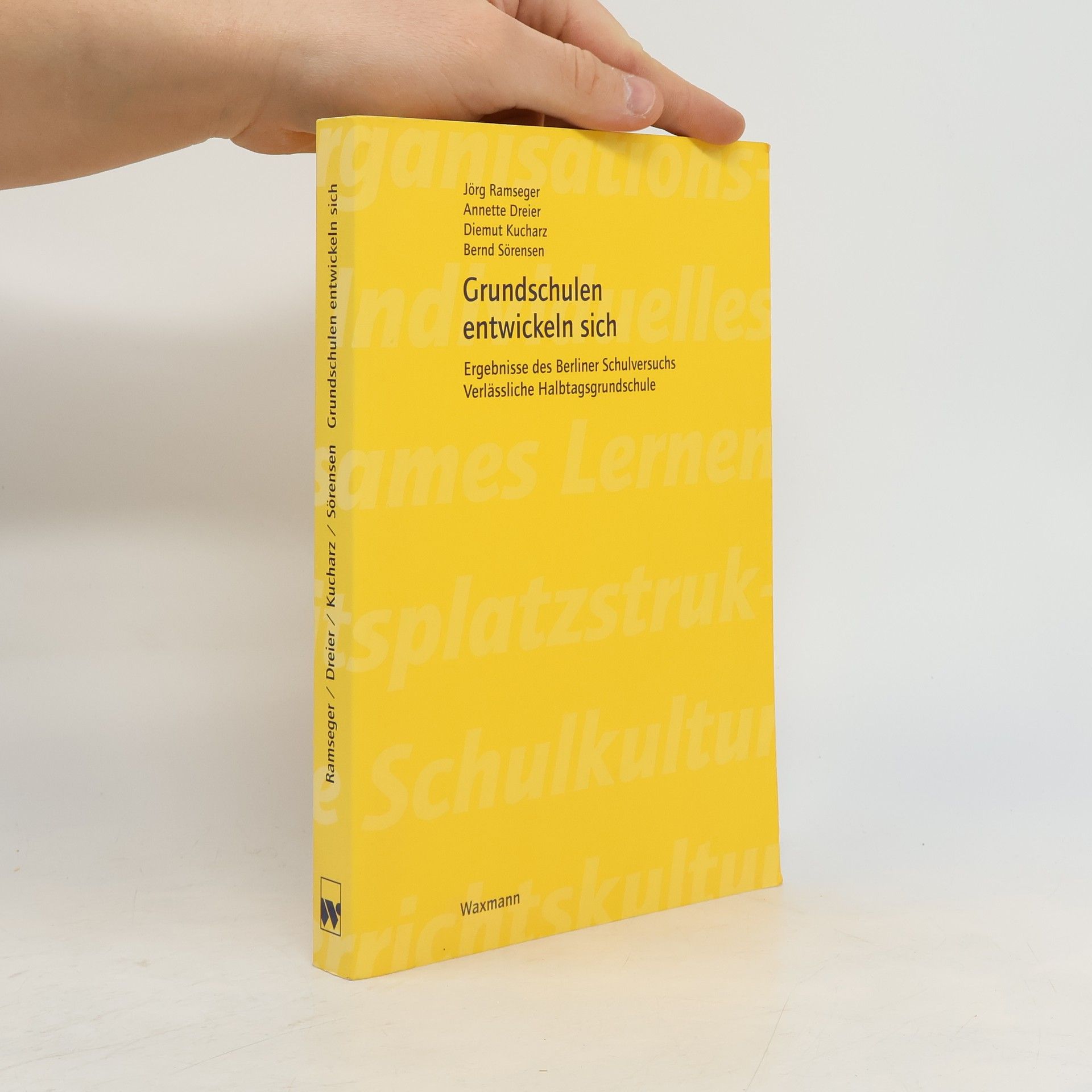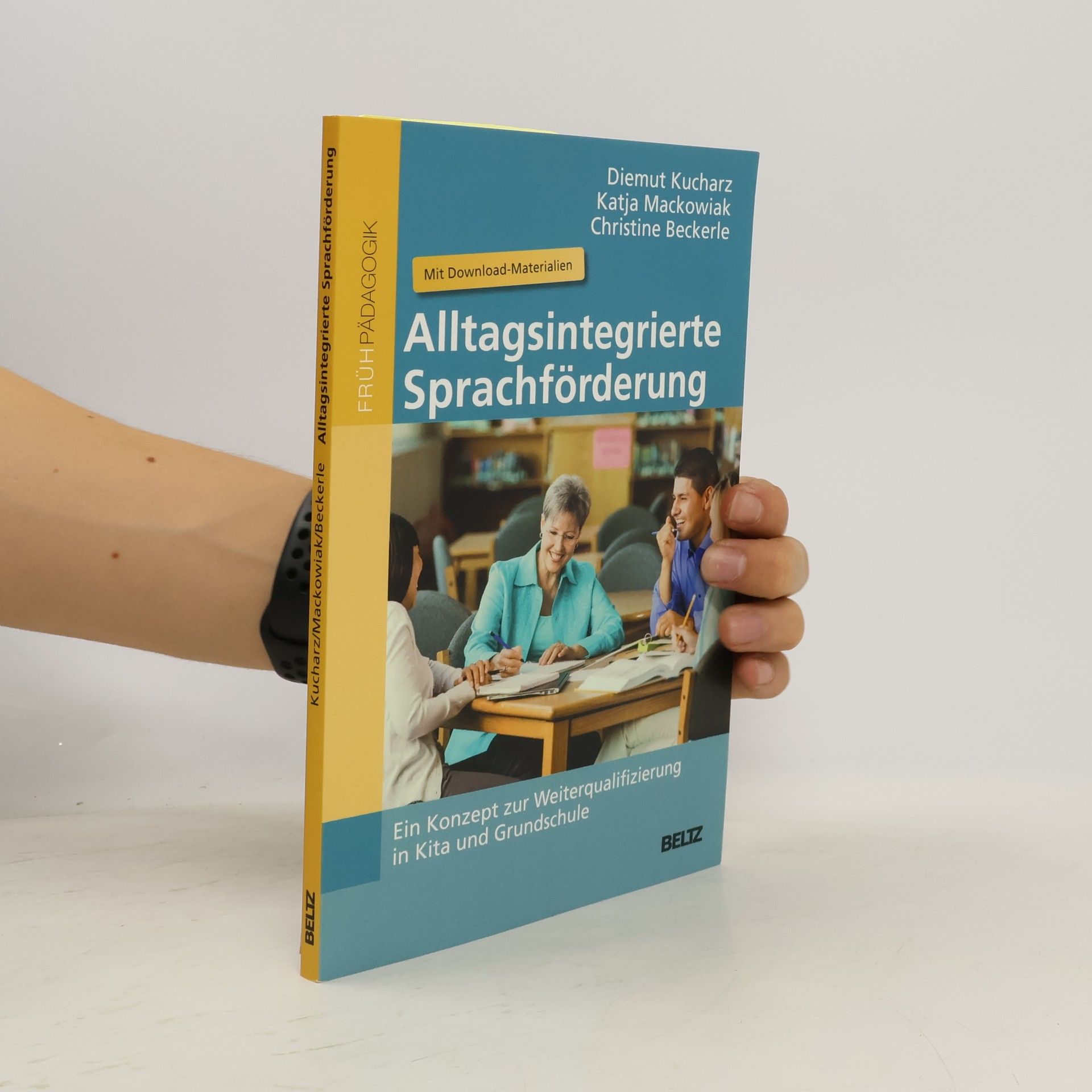Wie Sprachförderung in Kitas gelingen kann
Erkenntnisse aus der BiSS-Initiative
In der Bund-Länder-Initiative "BiSS – Bildung durch Sprache und Schrift" wurden von 2012 bis 2019 Maßnahmen zur Sprachbildung und -förderung von Kindern und Jugendlichen in den verschiedenen Bildungsetappen entwickelt, erprobt, evaluiert und optimiert. Der vorliegende Band fasst die theoretisch und empirisch fundierten BiSS-Erkenntnisse zum Elementarbereich für die Kita-Praxis zusammen. Sie geben Kriterien und Hinweise für eine gelingende Gestaltung von Sprachförderung, die dazu beitragen können, Sprachförderpraxis hinsichtlich ihrer Qualität zu beurteilen und notwendige Verbesserungen anzuregen.