Der Band bietet strukturierte Antworten zu Fragen des steuerlichen Verfahrensrechts in Abgabenordnung und Finanzgerichtsordnung. Er ist hilfreich für die Ausbildung zum Diplom-Finanzwirt und zur Steuerberaterprüfung sowie als Nachschlagewerk in der Praxis. Die Neuauflage berücksichtigt wichtige Rechtsänderungen bis April 2024.
Thomas Grosse Livres
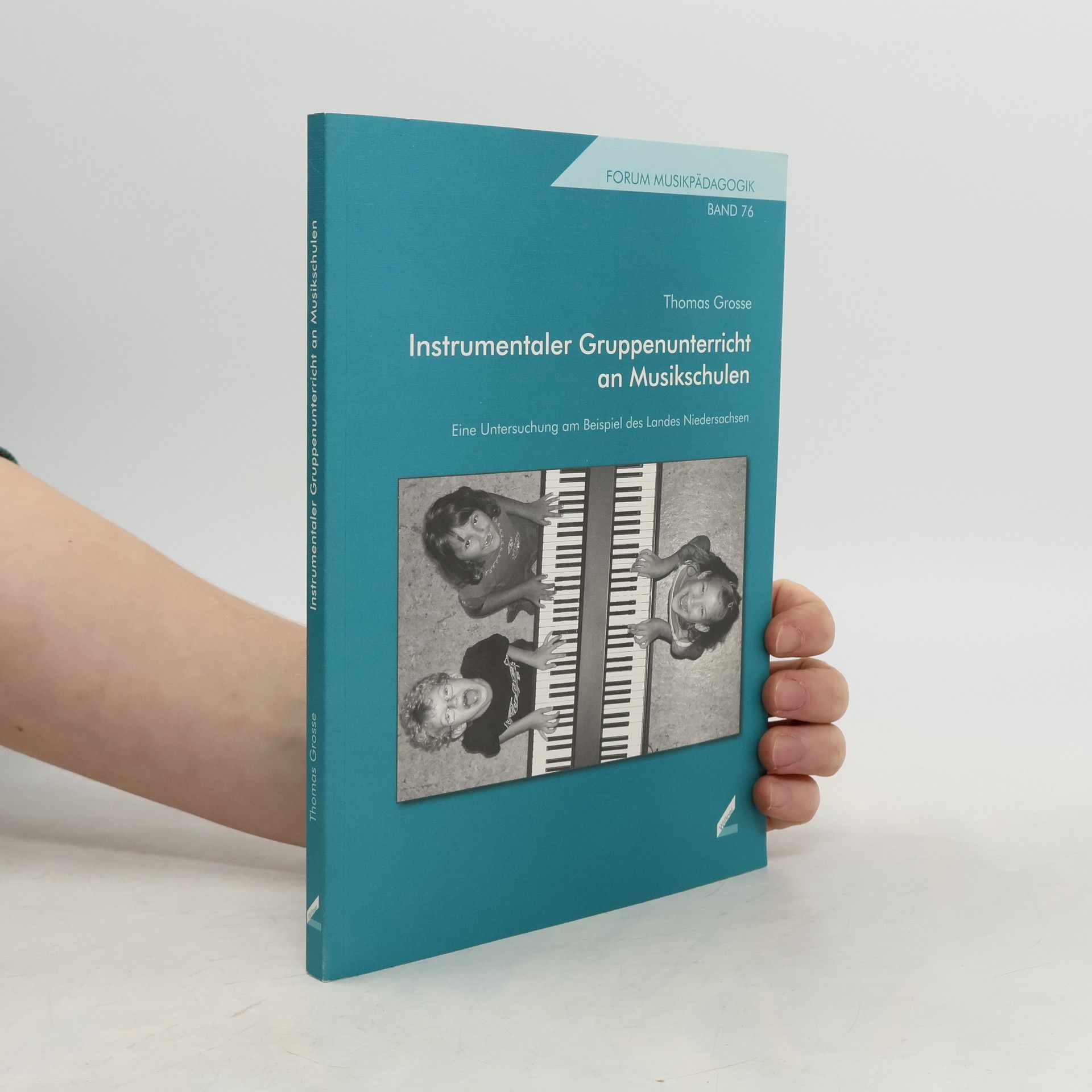
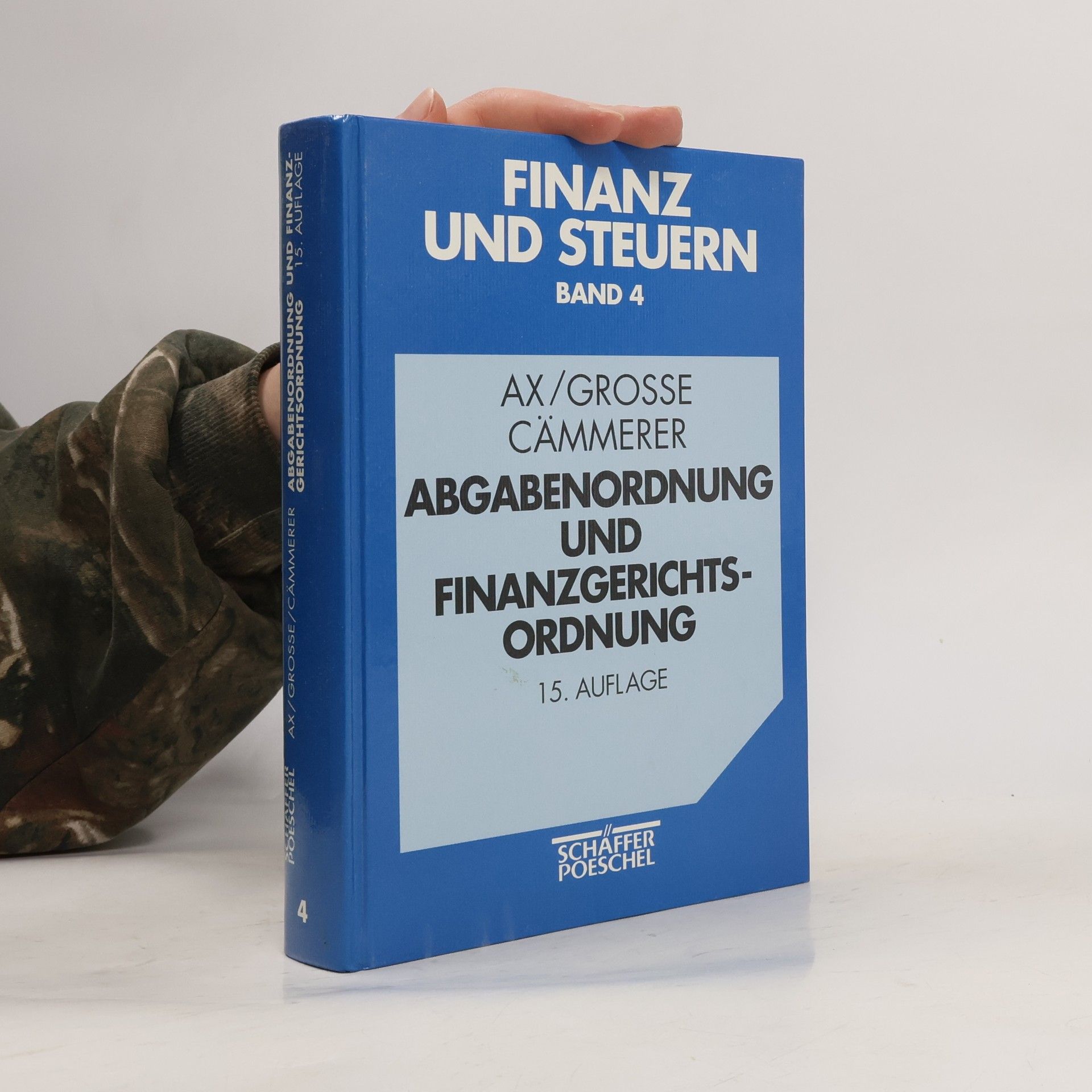
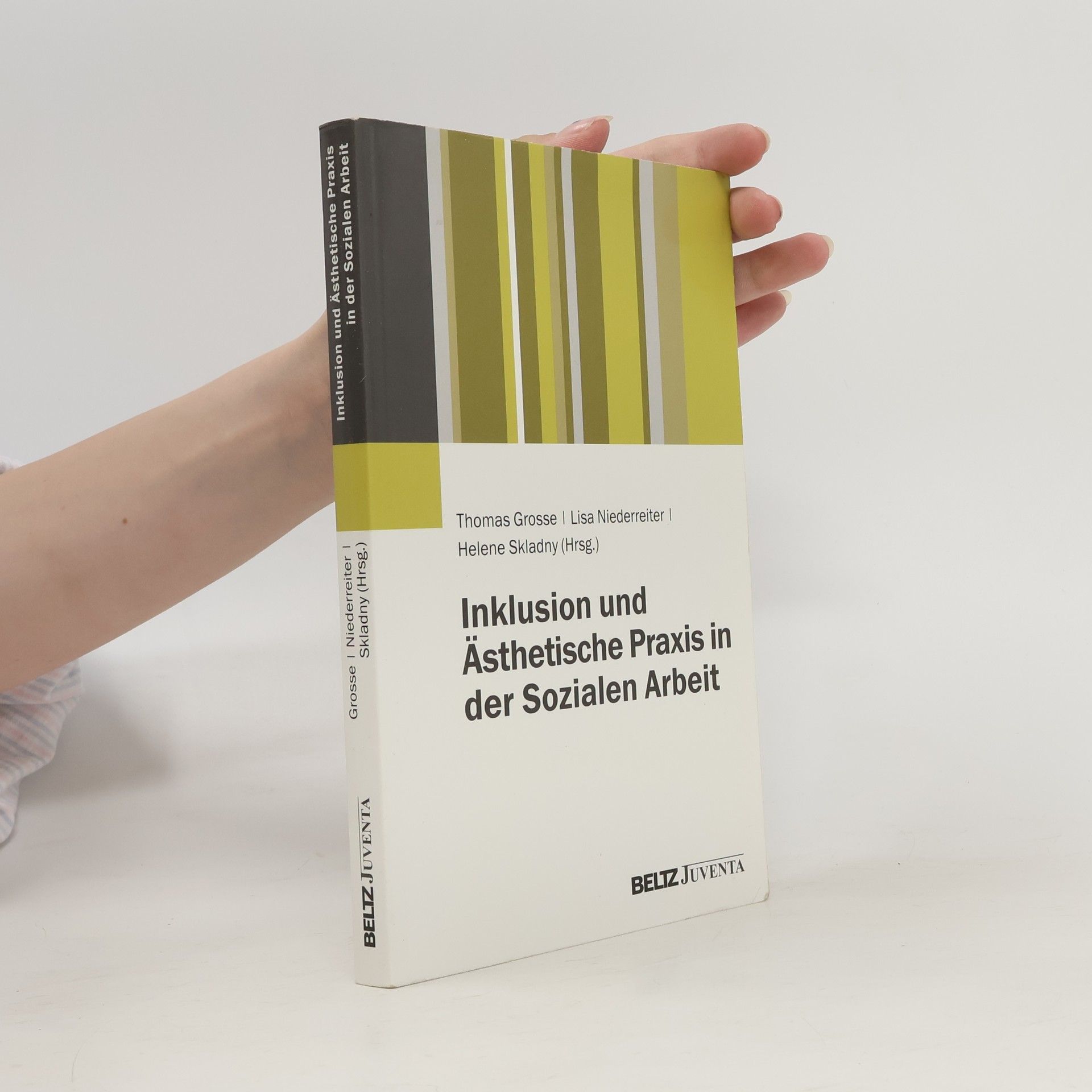


Dieser Leitfaden zur AO-Klausur bietet eine schrittweise Herangehensweise zur Bewältigung der Herausforderungen der Steuerberaterprüfung. Er erklärt den Aufbau und die Lösung im Gutachtenstil, unterstützt durch Tipps und gesetzliche Vorschriften. Inklusive vier Übungsklausuren zur Selbstkontrolle.
Dieser facettenreiche Sammelband bietet einen Überblick inklusiver Arbeitsansätze und Praxisprojekte Sozialer Arbeit in den Bereichen Kunst, Musik, Sprache, Medien und Theater. Ästhetische Praxis in der Sozialen Arbeit verfügt über eine lange Tradition, künstlerische Medien zeichnen sich durch niedrigschwellige, häufig nicht sprachgebundene Zugänge aus. Berufsfelder der Sozialpädagogik und Sozialarbeit werden von heterogenen Gruppen geprägt, lebenswelt- und situationsbezogene Angebote sind deshalb die Regel. So liegt es nahe, sich der in Theorie und Praxis Sozialer Arbeit angelegten Debatte um Inklusion von dieser Seite zu nähern. Lehrende aus dem Sozialwesen ermöglichen einen handlungsorientierten Blick in die Berufspraxis sozialer Arbeitsfelder und geben Anregungen für eine – von einem weit gefassten Inklusionsbegriff ausgehende – Beschäftigung mit der Thematik.
Finanz und Steuern - 4: Abgabenordnung und Finanzgerichtsordnung - 15. Auflage
- 704pages
- 25 heures de lecture
Forum Musikpädagogik - 76: Instrumentaler Gruppenunterricht an Musikschulen
Eine Untersuchung am Beispiel des Landes Niedersachsen
- 210pages
- 8 heures de lecture