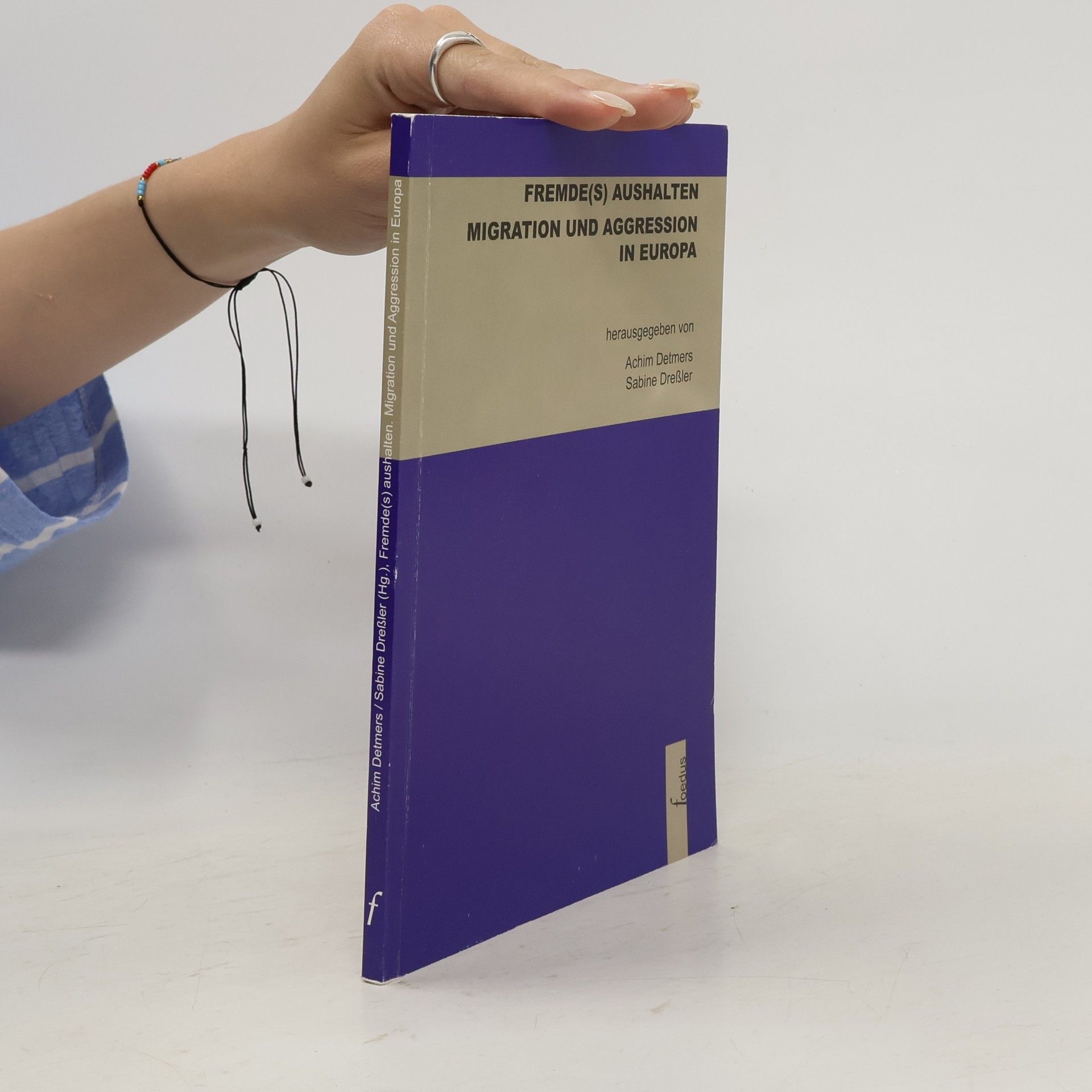Die Beiträge dieses Buches sind für eine Tagung im Jahr 2016 entstanden, die sich mit der Erfahrung von Flucht, Vertreibung und Exil in der Geschichte und Gegenwart reformierter Kirchen auseinander setzte. Aspekte der Theologie Calvins werden ebenso behandelt wie die Erfahrungen der Hugenotten.
Achim Detmers Livres