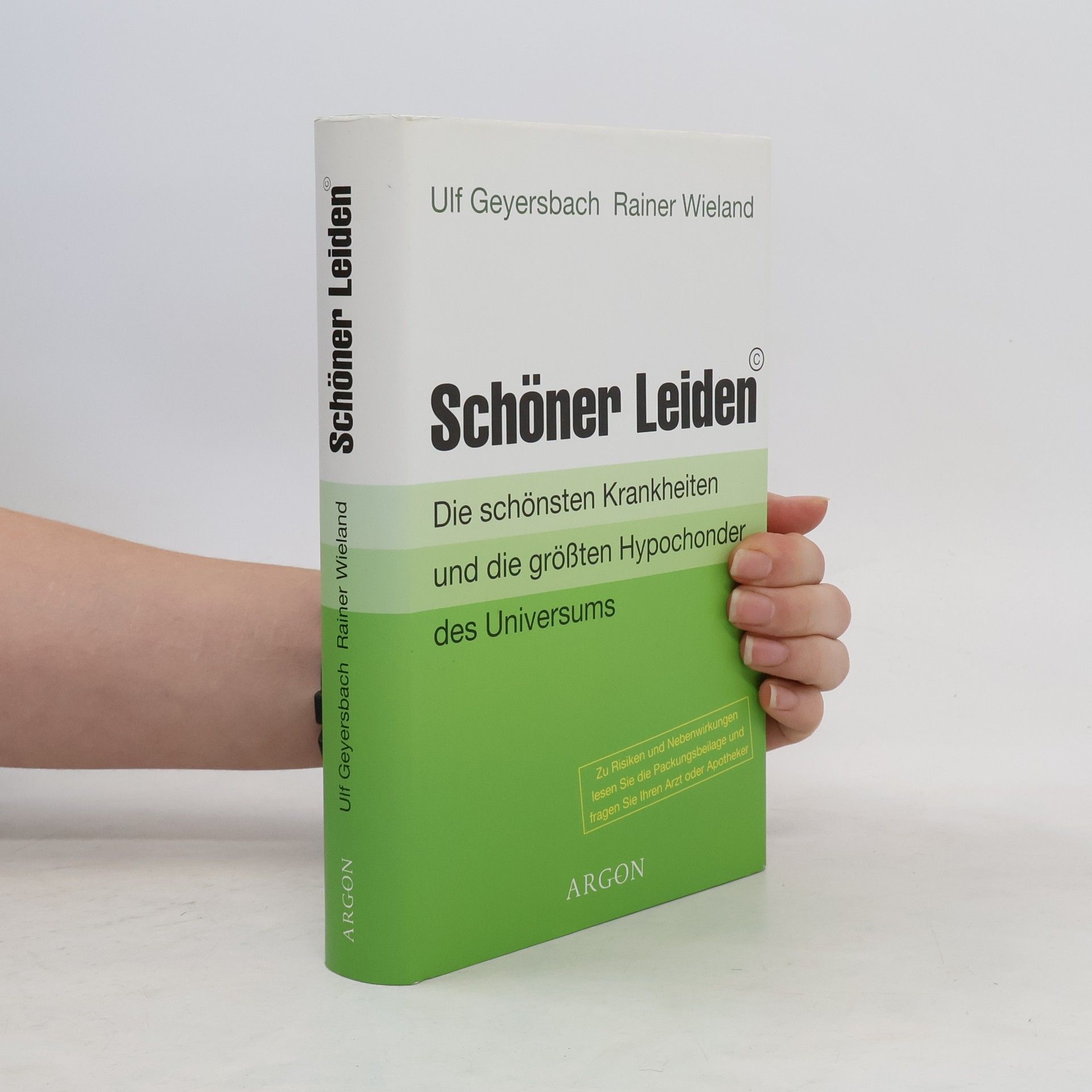Machandels Gabe
- 283pages
- 10 heures de lecture
Die sonderbare Geschichte vom Winzling Machandel, der auszog, der Welt das Geschenk des feinen Geschmacks zu machen, ist ein beeindruckendes Romandebüt. Ulf Geyersbach erzählt mit einer Wort- und Bildgewalt, die in der deutschen Literatur lange nicht zu finden war. Im Jahr 1769 wird in einer Schäferhütte in der Niederlausitz Ignatz Machandel geboren, in einer Welt voller Dreck und übler Gerüche. Schon als Kleinkind probiert er alles, was er findet, und prägt sich unzählige Aromen ein. Nach sieben Jahren des Experimentierens hört er auf zu wachsen und beginnt zu kochen. Bald ist er in der Region bekannt für seine außergewöhnlichen Speisen. Als ein harter Winter eine Hungersnot auslöst und seine Mutter ins Siechenhaus gebracht wird, kommt Machandel in ein Kloster. Dort erfährt er von dem berühmten Pariser Koch Baffour, der Gesellen sucht. Entschlossen macht sich Machandel auf den Weg nach Paris, um die Aromen von Liebe, Ruhm und Verrat zu entdecken und ein bahnbrechendes Buch zu schreiben, dessen Exemplar heute in der Berliner Staatsbibliothek aufbewahrt wird.