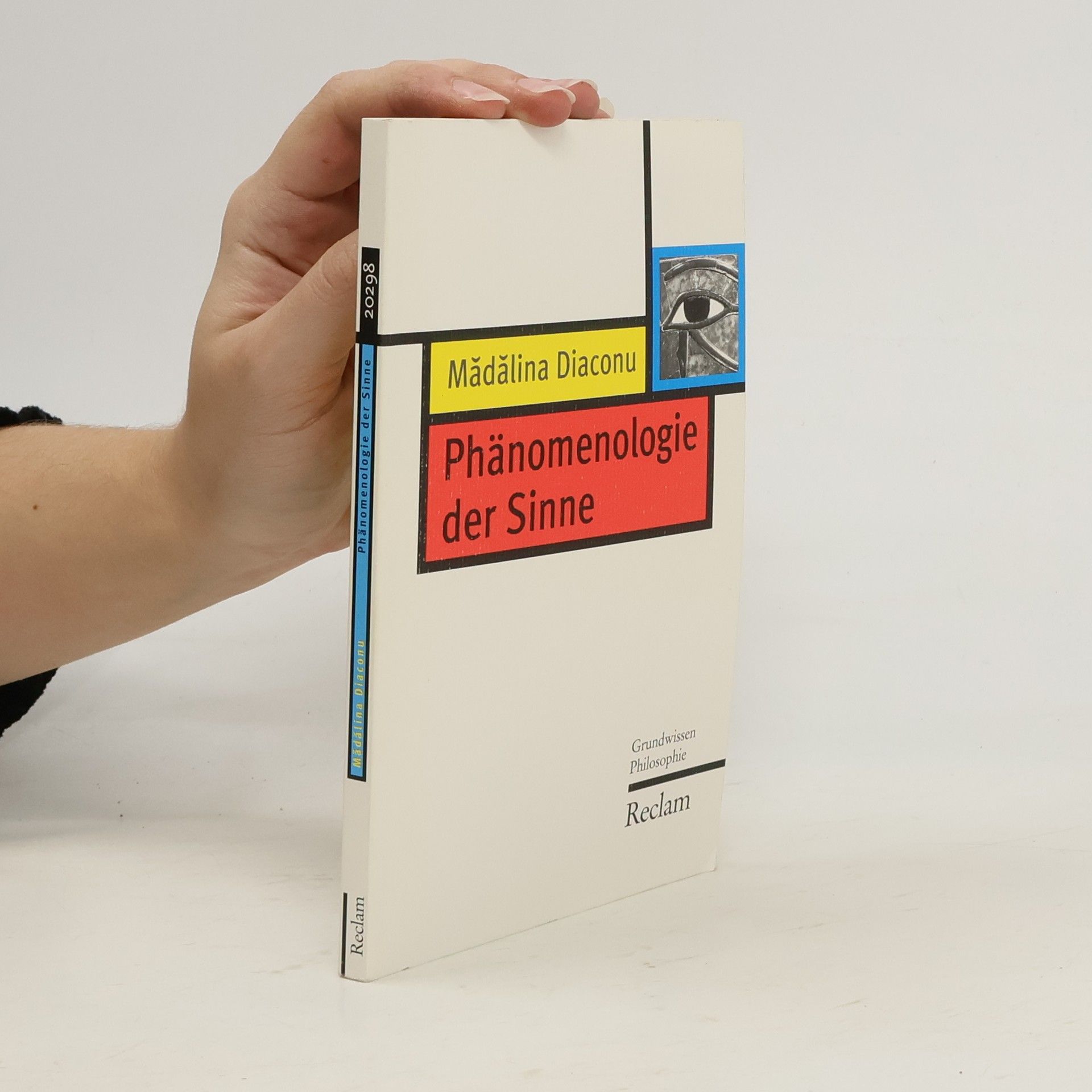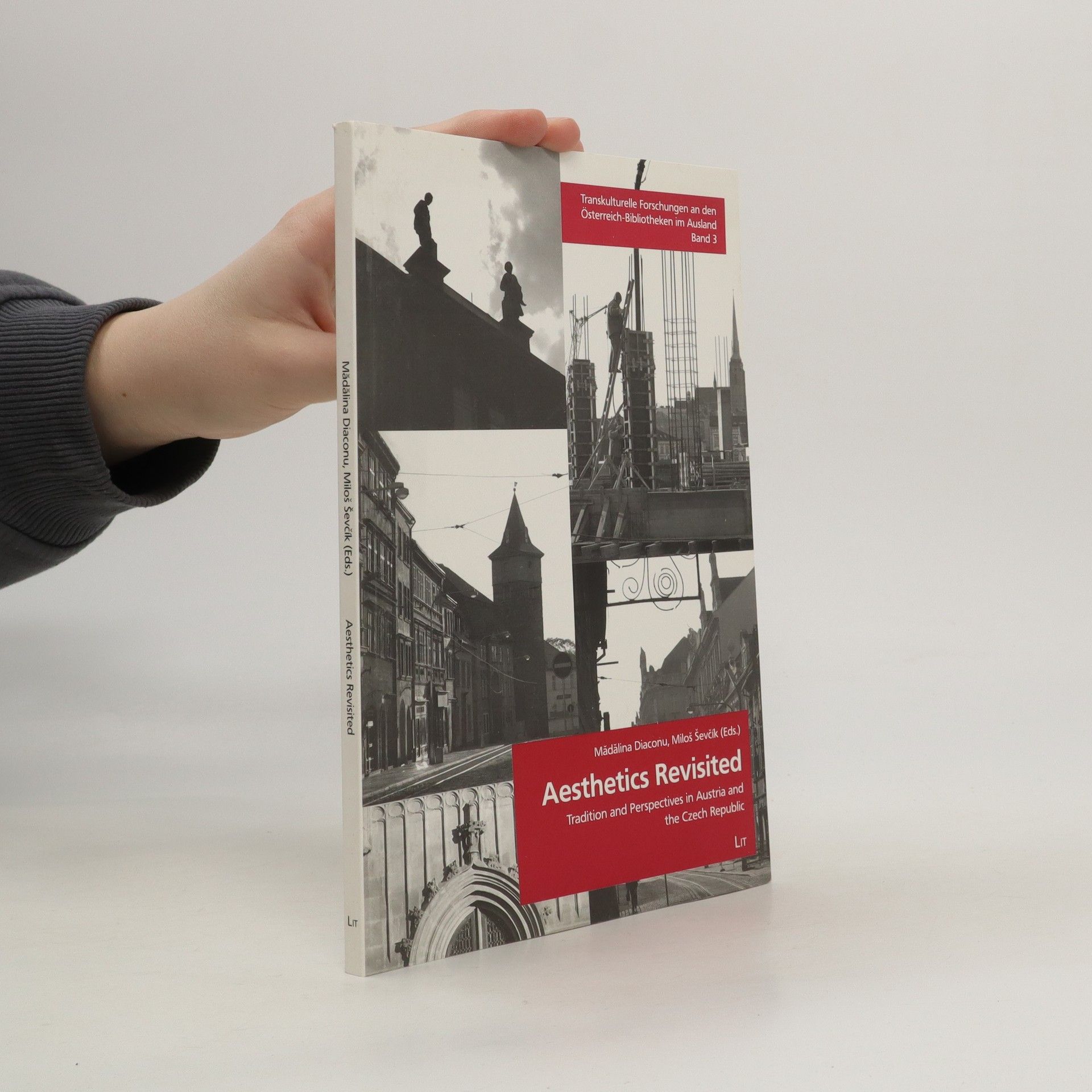Aesthetics revisited
- 143pages
- 6 heures de lecture
The volume represents a selection of the articles which were presented at a colloquium on new research topics in aesthetics at the Austrian Library in Pilsen in September 2010. Their authors, Czech and Austrian scholars, address various topics, ranging from the institutional history of aesthetics to the relationship between philosophical aesthetics and psychology, and from the philosophy of literature to the aesthetics of fine arts, dramatic arts, and architecture.