Karriere eines konstruierten Gegensatzes: Zehn Jahre "Muslime versus Schwule"
Sexualpolitiken seit dem 11. September 2001
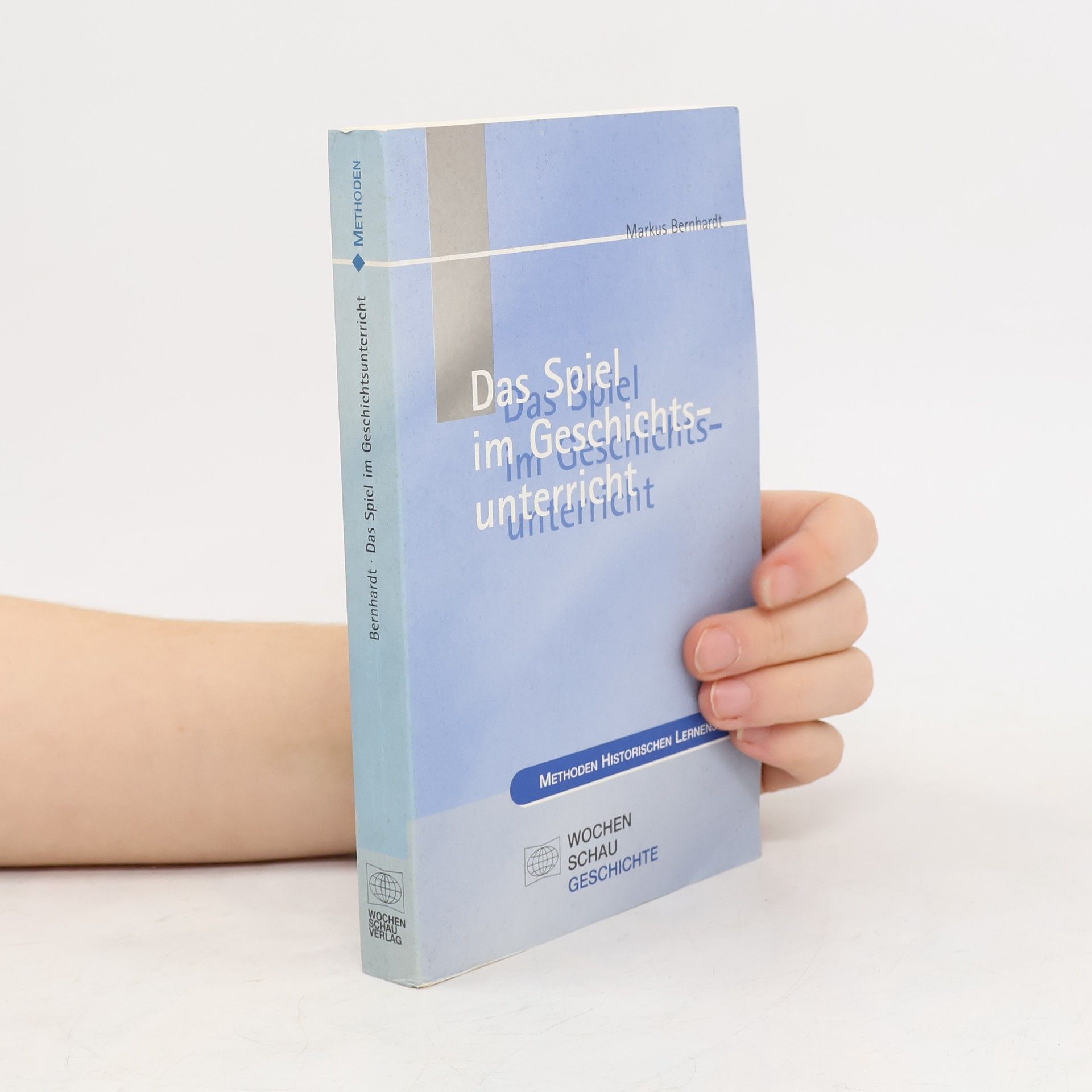
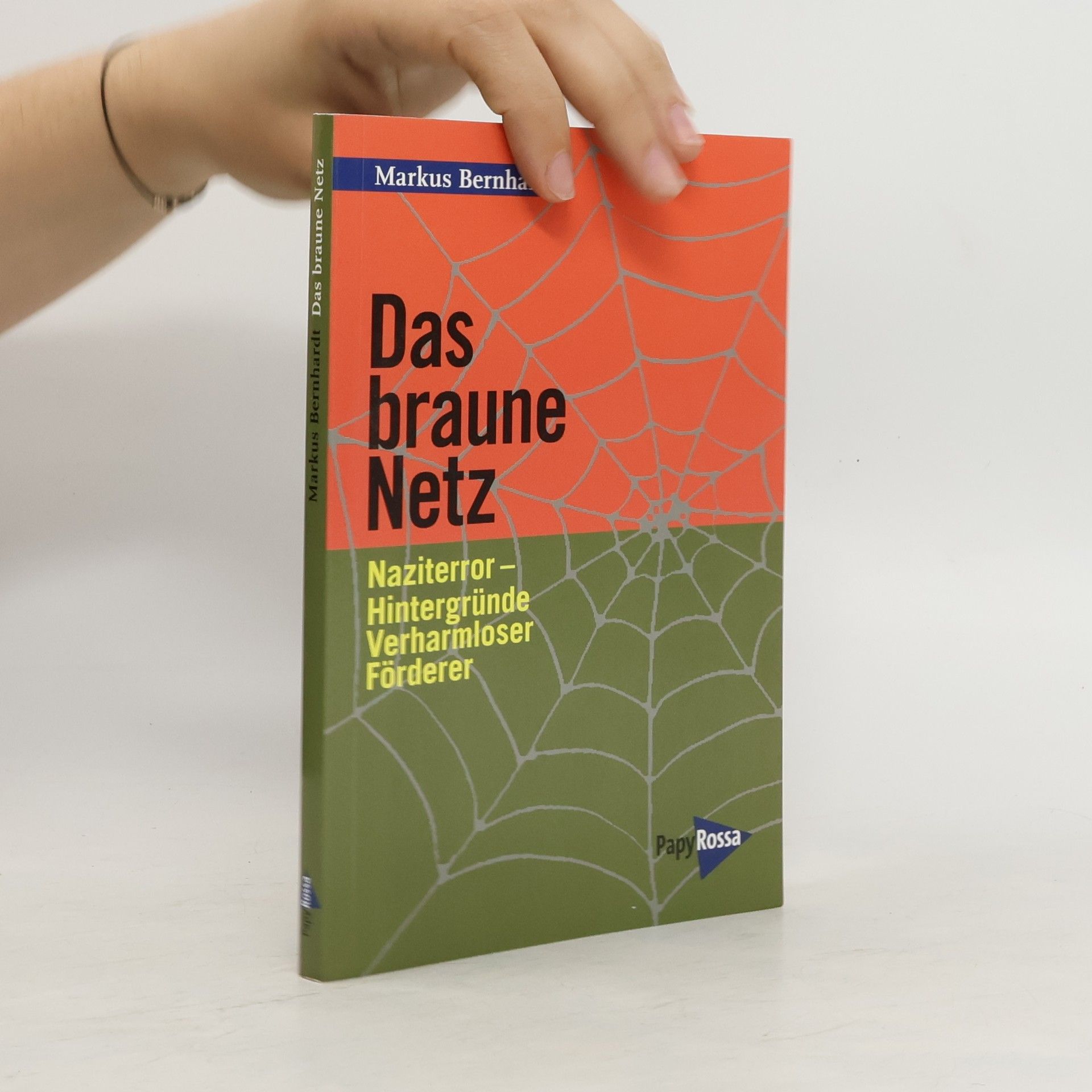

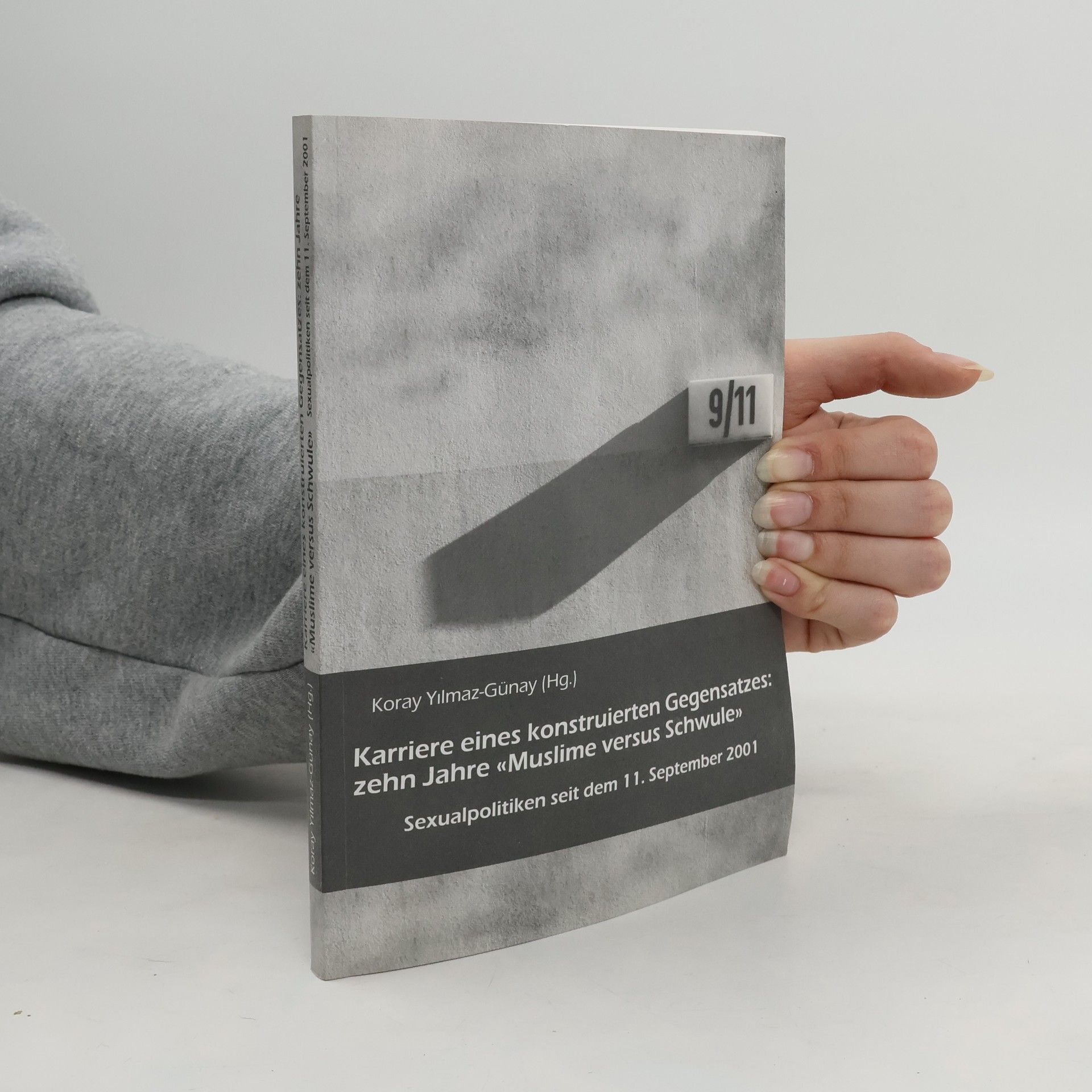
Sexualpolitiken seit dem 11. September 2001
Kulturelle Begegnung – Soziale Ungleichheit – Inklusion in Geschichte und Gegenwart
Das Thema Inklusion wird in Deutschland breit diskutiert – insbesondere mit Blick auf Schule und Bildung. In der Lehrer*innen-Ausbildung gilt es, das Thema zu verankern und Studierende auf die damit verbundenen Herausforderungen vorzubereiten. Dieses Buch leistet einen Beitrag dazu. Es richtete sich an Studierende, Referendar*innen und Lehrende. Der Band eröffnet eine weite Perspektive auf Formen von Inklusion, sozialer Ungleichheit und kultureller Begegnung in der Geschichte. Der Bogen reicht dabei von der Antike bis in die Gegenwart. Er bietet zahlreiche Anregungen für historische und geschichtsdidaktische Fragestellungen, mit denen sich neue Impulse im Unterricht setzen lassen, um Schüler*innen so Orientierung in der multikulturell und global geprägten Lebenswelt des 21. Jahrhunderts zu ermöglichen.
Als im November 2011 eine neofaschistische Terrorgruppe aufflog, die mehr als dreizehn Jahre lang ungehindert morden und bomben durfte, wurden Zusammenhänge ruchbar, die so mancher Verschwörungstheorie den Rang ablaufen. Die Terroristen waren nicht etwa nur von den Strafverfolgungsbehörden nicht behelligt, sondern von den Inlandsgeheimdiensten auch noch gefördert worden. Während der größte Geheimdienstskandal in der Geschichte der Bundesrepublik trotz aller gegenteiligen Enthüllungen von offizieller Seite noch immer als Panne verharmlost und in seinem wahren Ausmaß zu verschleiern versucht wird, leuchtet Markus Bernhardt die Hintergründe des Zusammenwirkens der Geheimdienste und militanten Neonazis aus und nennt Verharmloser, Vertuscher und Förderer beim Namen. Und er weist schlüssig nach, dass die zur Staatsdoktrin erhobene Gleichsetzung von 'rot' und 'braun' letztlich ein ideologisches und politisches Instrument gegen einen konsequenten Antifaschismus darstellt und wirksame Maßnahmen gegen den Rechtsextremismus verhindert.