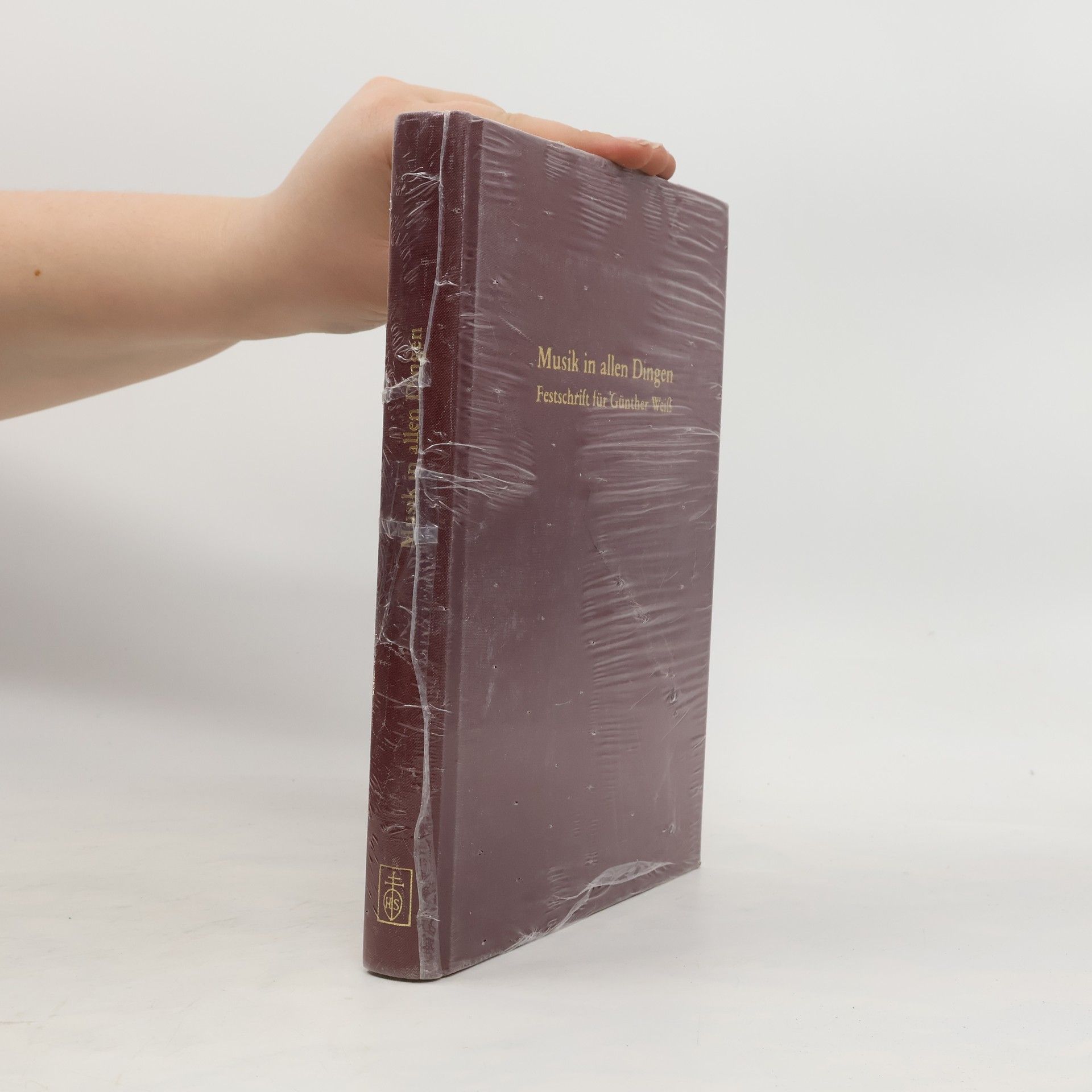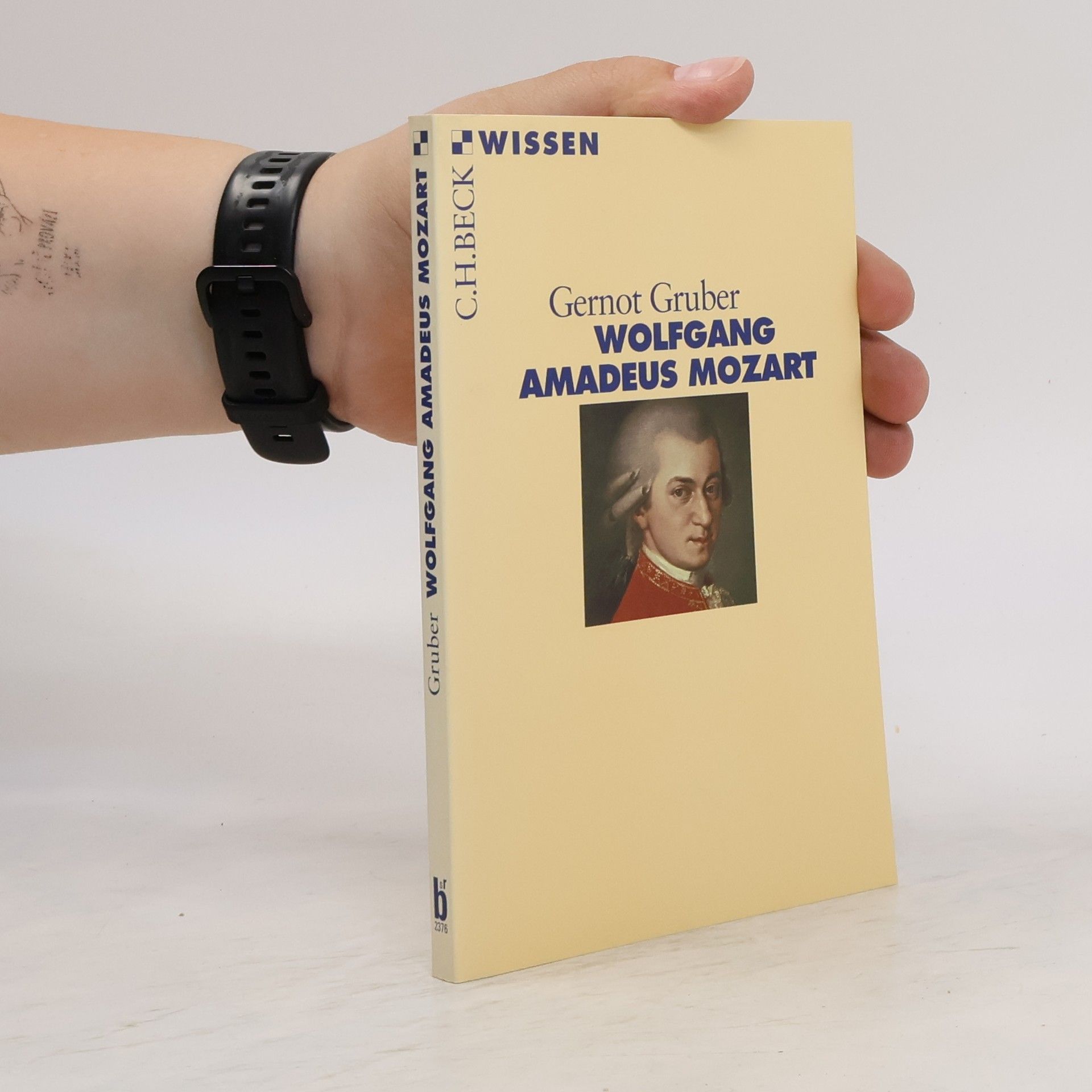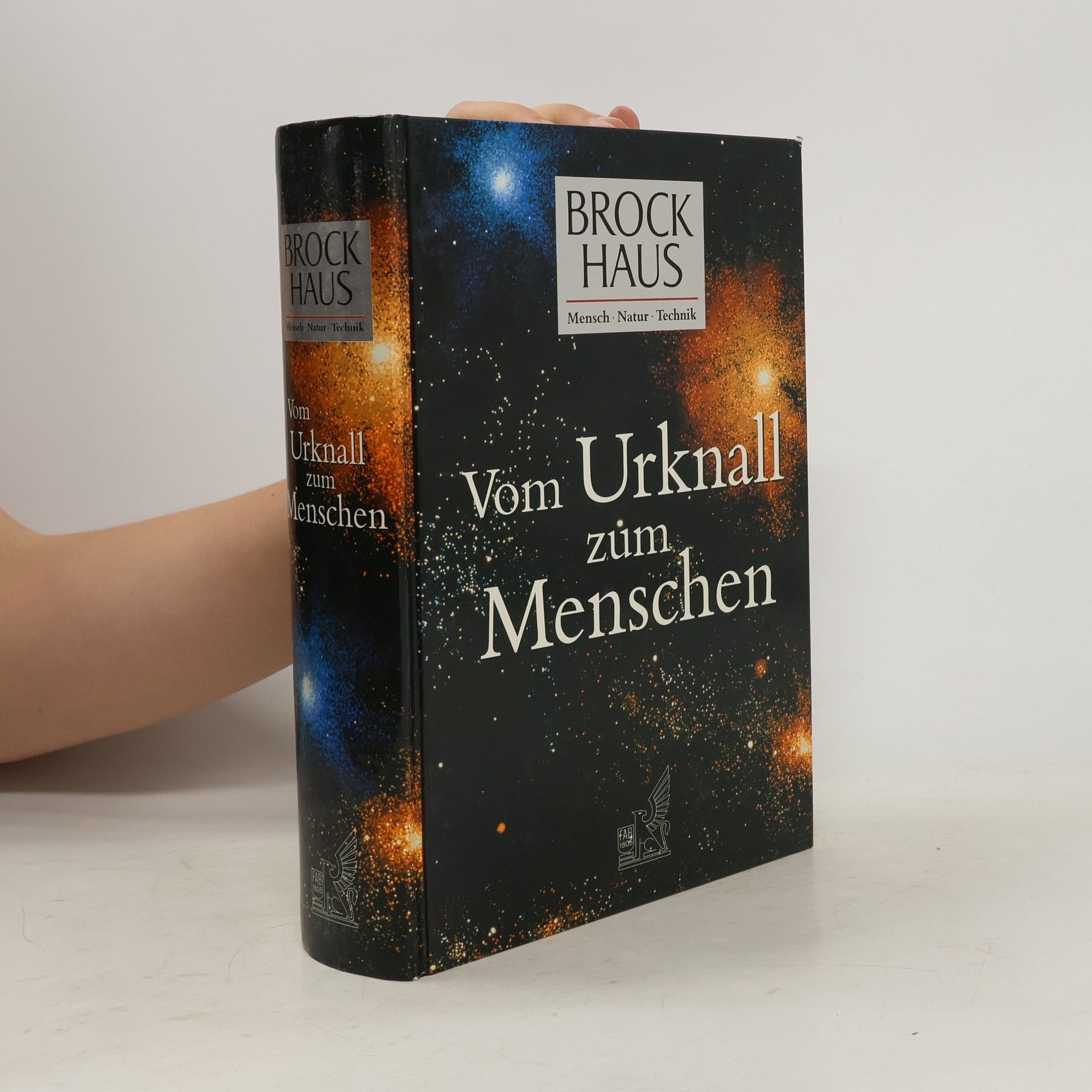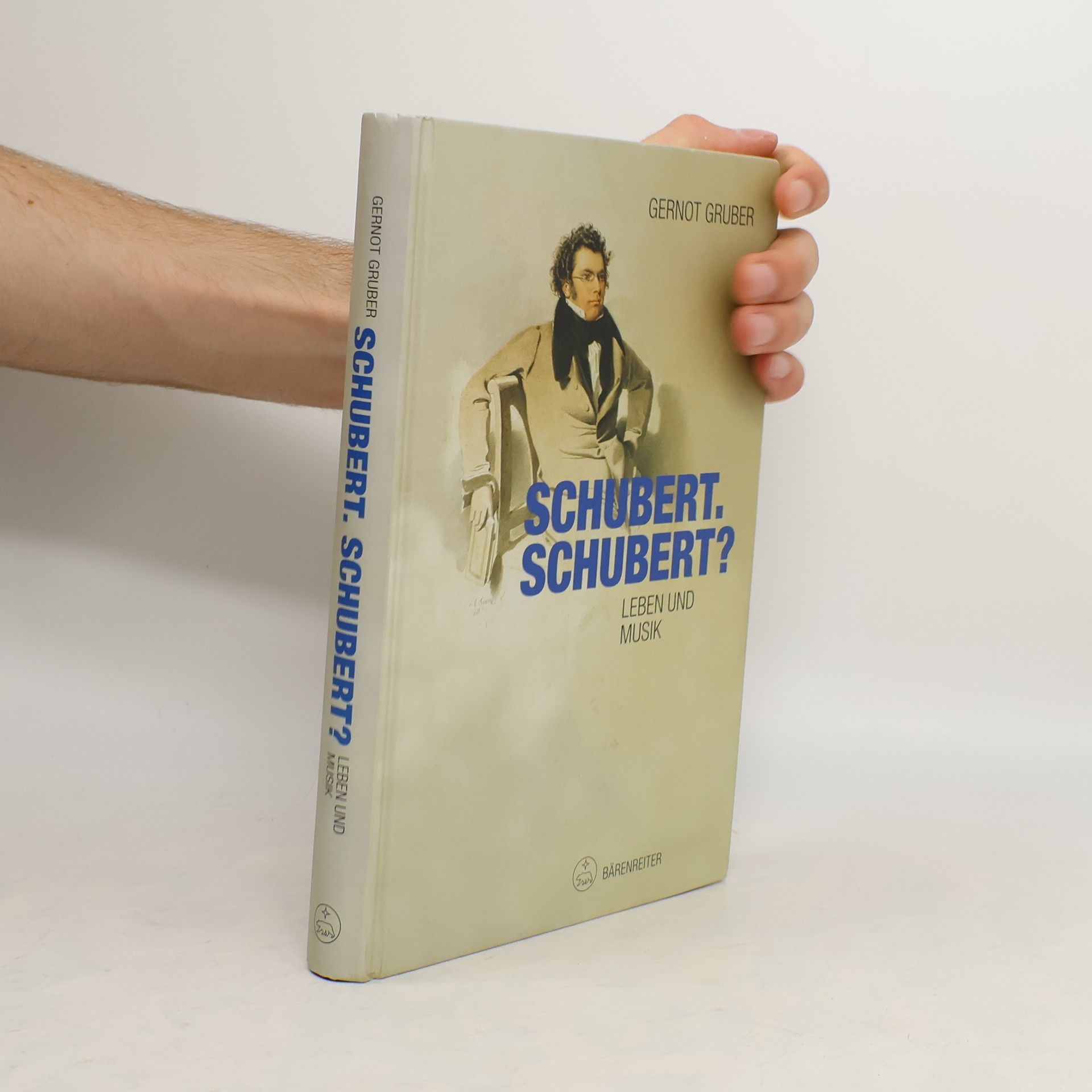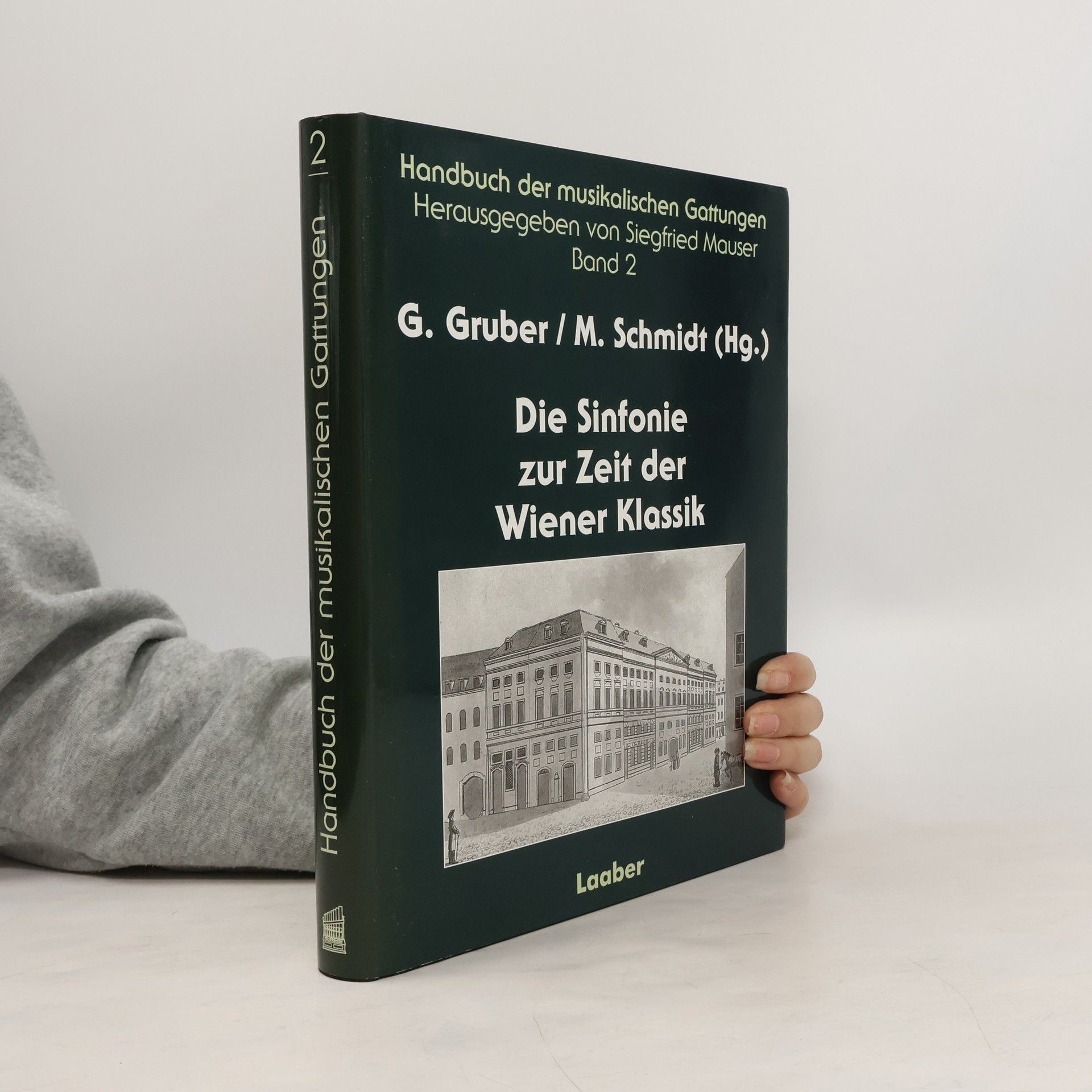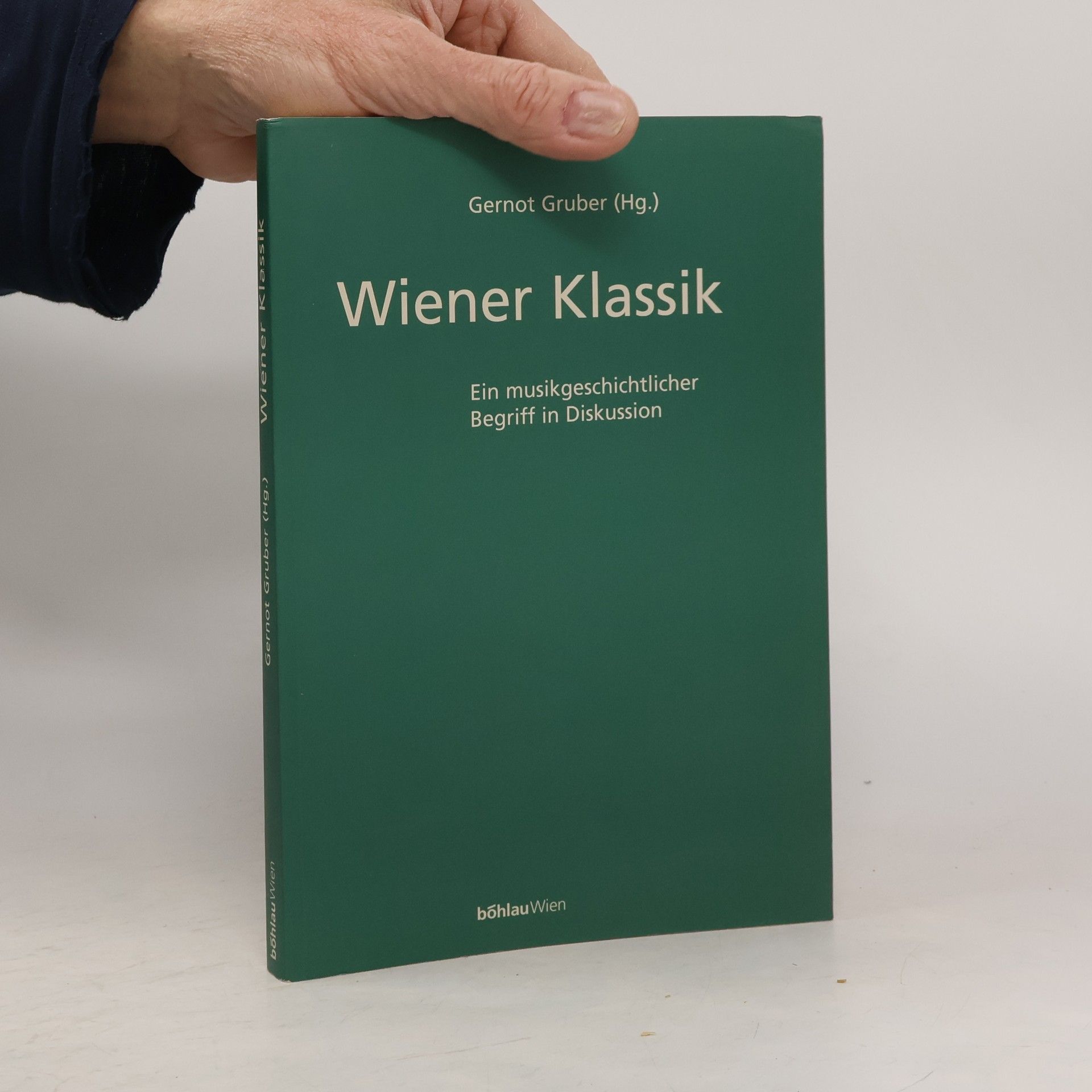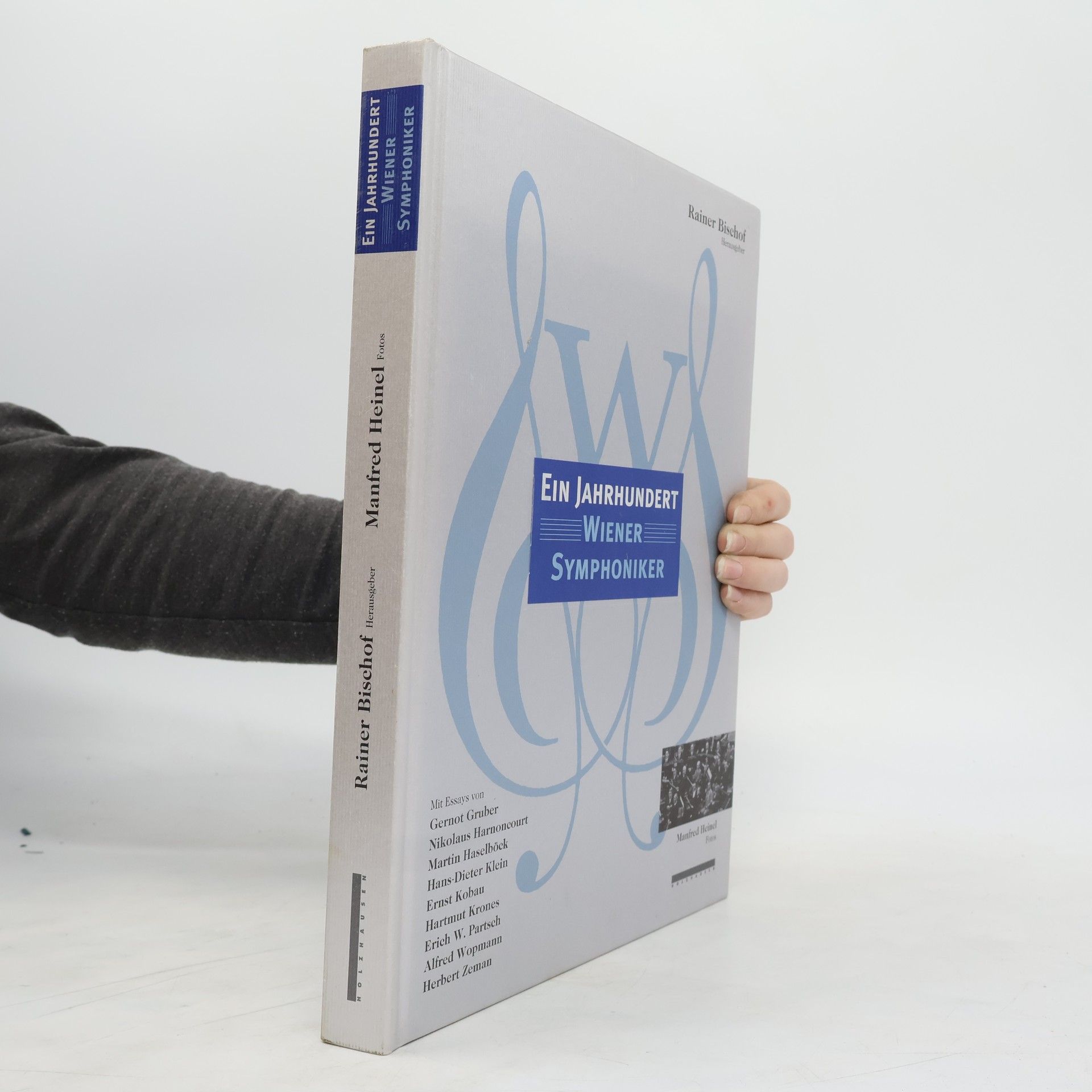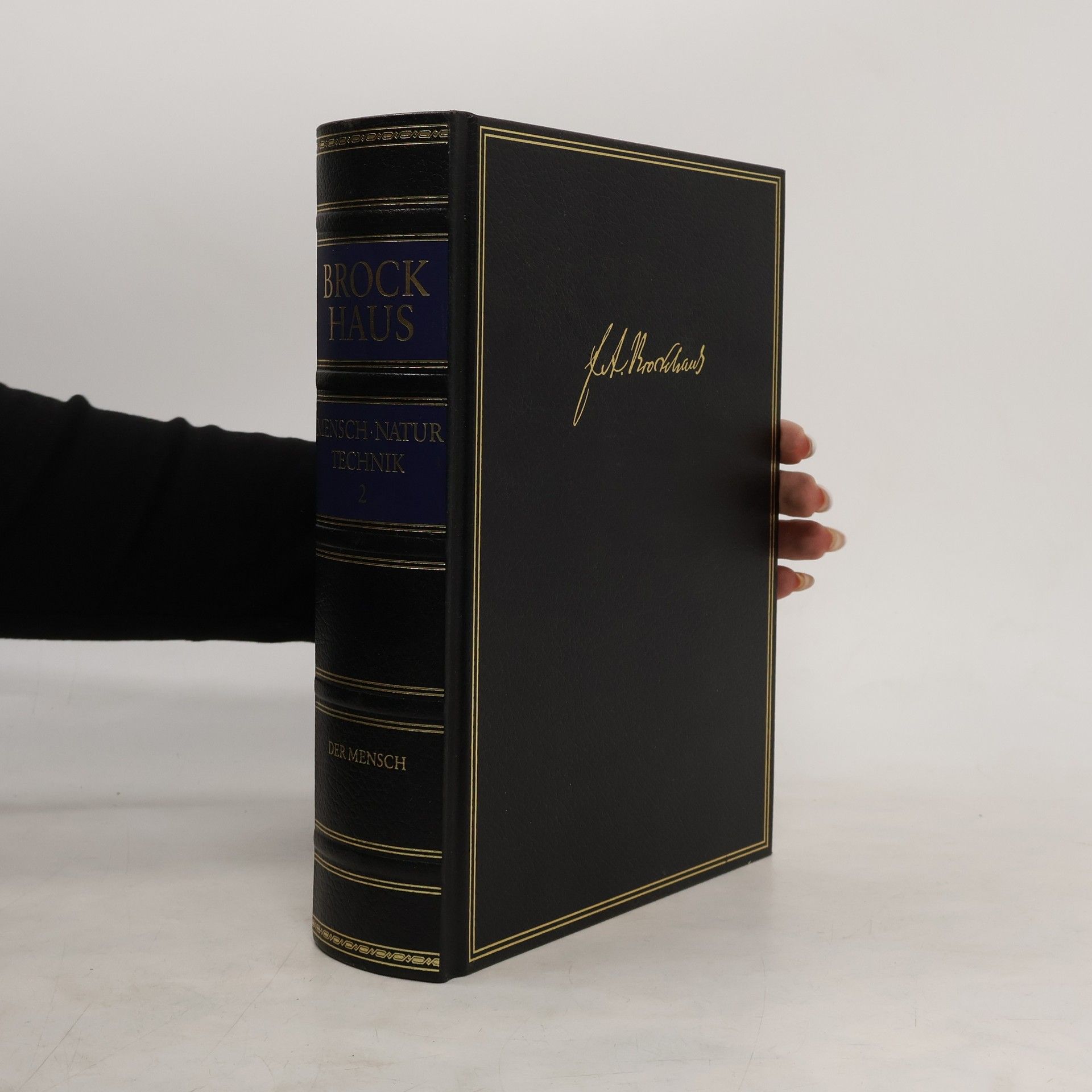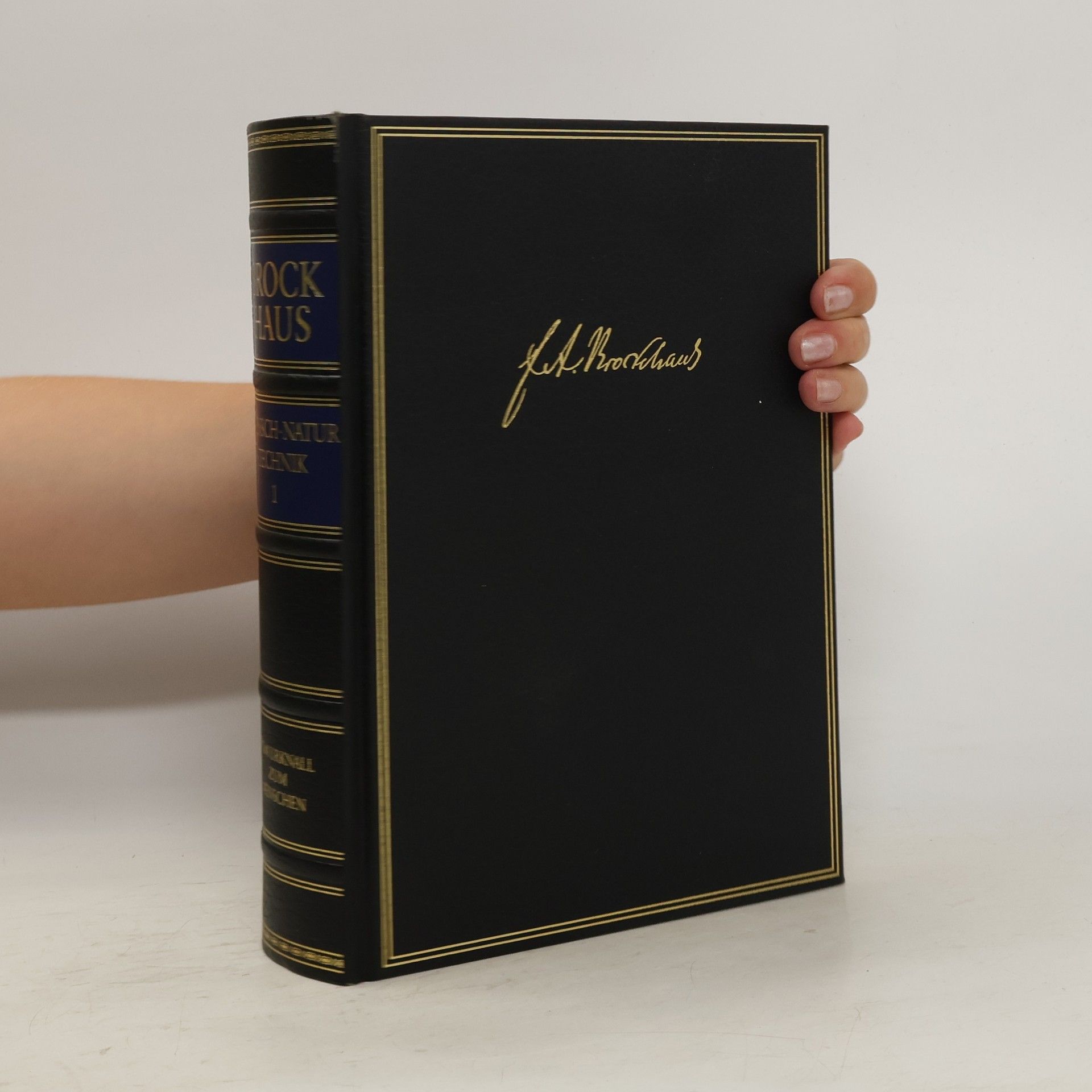Kulturgeschichte der europäischen Musik
Von den Anfängen bis zur Gegenwart
Dieses Buch zeichnet ein weites historisches Panorama Europas und der „abendländischen Welt“ anhand der Musik, mit deren Hilfe die Menschen ihre Kulturen seit jeher gestaltet haben. Gernot Gruber erzählt die Geschichte der Musik von ihren Anfängen in vorgeschichtlicher Zeit bis in die jüngste Gegenwart mit ihrer globalisierten E- und U-Musikszene. Und er schildert, mal im Detail und mal in großen Zügen, wie eng Musik mit Religion und Kultus, mit Macht und Politik, mit Alltag und Lebensbewältigung verbunden war. - Damit bietet diese Kulturgeschichte etwas anderes als die bekannten Sie geht von den Kontexten aus, die als Ideengeschichte, Sozial- und politische Geschichte die Musik tragen. Und sie schildert anschaulich die Spannung zwischen dem allgemeinen Leben und dem Eigenleben der Musik als Kunst. Den roten Faden bildet dabei die Frage nach dem Europäischen in der Musik, nach dem Verhältnis zwischen Pluralität und Identität und wohin diese Geschichte in unserer Gegenwart fü Löst sich die aktuelle „europäische Identität“ auf – oder gibt nicht gerade der innovative Umgang mit dem global verbreiteten Kanon europäischer Musik die Chance auf einen Halt?