Eine Einladung ins Mittelalter! Das Oldenbourg Geschichte Lehrbuch Mittelalter bietet einen idealen Einstieg in diese Epoche und dient als Leitfaden für Studierende sowie als wertvolle Ressource für Fortgeschrittene, Dozenten und Lehrer. Es behandelt die Entwicklung monarchischer Herrschaft in Europa, untersucht die Einflüsse der römischen und byzantinischen Kultur, die Stammestraditionen und die Christianisierung in Früh-, Hoch- und Spätmittelalter. Ein weiterer Zugang ist die Geschichte sozialer Gruppen, wobei nach einer kurzen Einführung prägende Gruppen wie Mönchsgemeinschaften, Gilden und frühe Universitäten vorgestellt werden. Die Leser lernen zudem wichtige Forschungsmethoden und Hilfswissenschaften kennen, von der Paläographie bis zu den Neuen Medien. Die Entwicklung der Mittelalterforschung, ihre Schlüsselbegriffe und Institutionen werden ebenfalls thematisiert. Technik-Beiträge beleuchten den Nutzen von Epocheneinteilungen, soziale Deutungsmuster als Interpretationshilfen, das Auffinden mittelalterlicher Überreste in der modernen Umgebung und die Arbeit in historischen Archiven. Die Autorinnen und Autoren sind Experten auf ihrem Gebiet und bieten ein umfassendes und vielfältiges Bild der Mittelalterforschung.
Matthias Meinhardt Livres
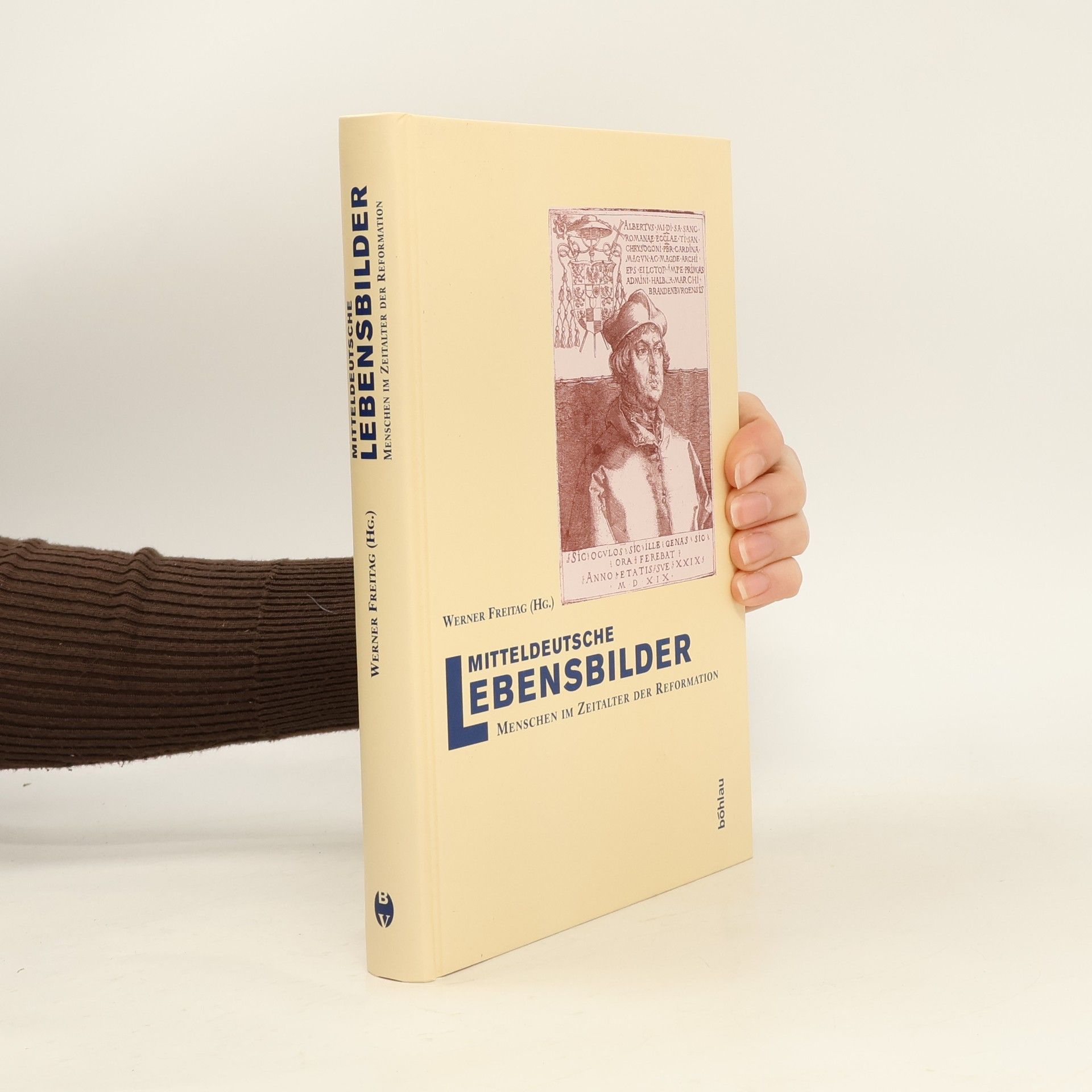


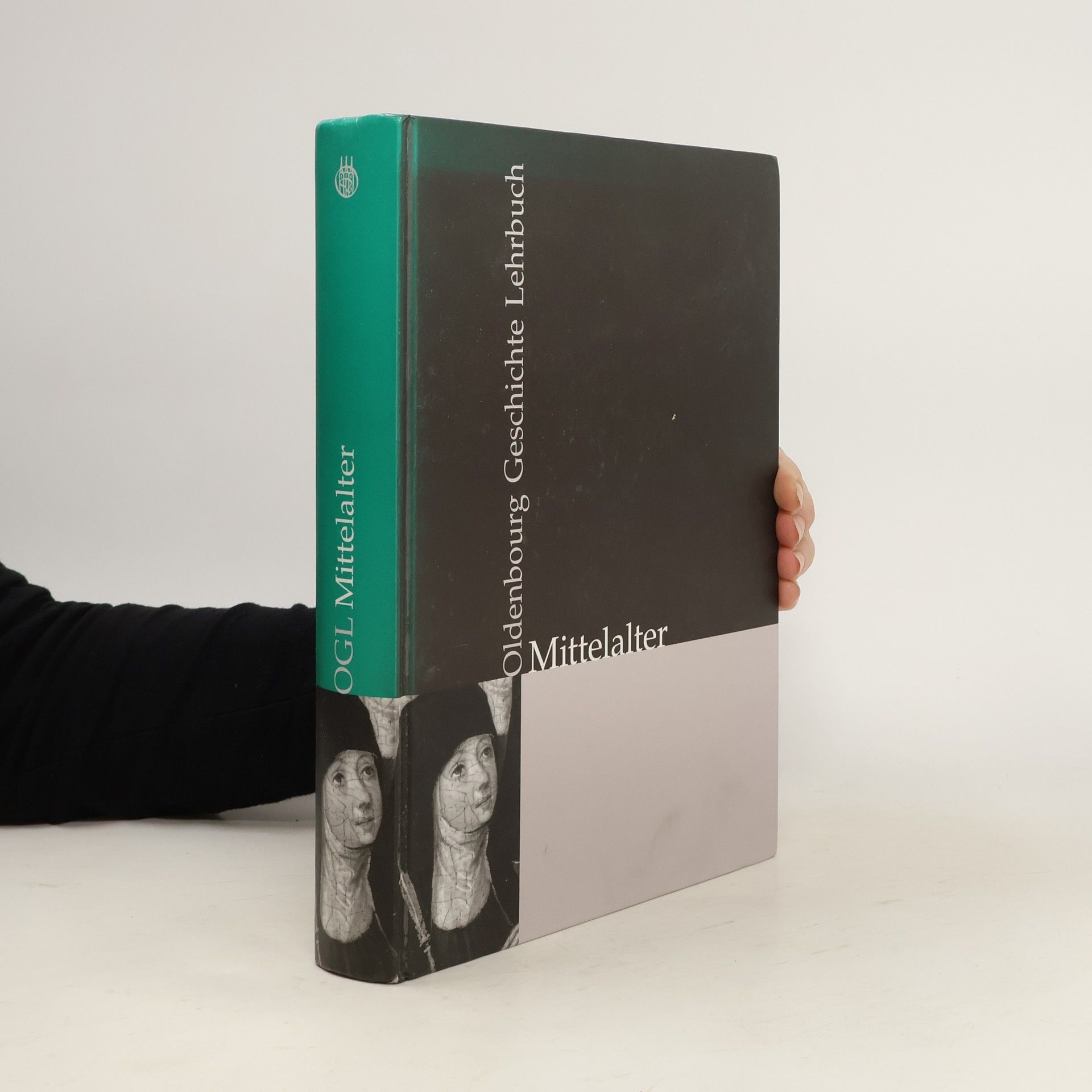
Die Beiträge des Bandes widmen sich der Verbindung von kriegerischem und unternehmerischem Handeln im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit. Das Kriegsunternehmertum wird dabei als eine langlebige, Raum und Epochen übergreifende Erscheinung betrachtet, die keineswegs nur ein "Übergangsphänomen" im Rahmen einer linearen Entwicklung von "mittelalterlichen Gefolgschaftsheeren" zu "frühstaatlichen Dienst- und Berufsheeren" war. Untersucht wird, unter welchen politischen, sozialen, technologischen und ökonomischen Bedingungen es entstehen, sich etablieren und entfalten, sodann aber auch wieder an Bedeutung verlieren konnte - ohne freilich je ganz verschwunden zu sein. Als gemeinsame analytische Kategorie wird dafür der Begriff der Kapitalisierung in einem weiten Bedeutungsspektrum herangezogen.
Im Jahr 2018 nahm die Reformationsgeschichtliche Forschungsbibliothek im Schloss Wittenberg ihre Arbeit auf. Das mit diesem Band erstmals vorgelegte Jahrbuch stellt bestandsorientierte Forschungsergebnisse vor und dokumentiert die wissenschaftliche Arbeit und das kulturelle Leben an der Forschungsbibliothek. Es enthält u. a. Beiträge einer Tagung über den Einfluss der Reformation auf die Funeralkultur.
Mitteldeutsche Lebensbilder
Menschen im Zeitalter der Reformation. Herausgegeben im Auftr. d. Histor. Kommission f. Sachsen-Anhalt
- 255pages
- 9 heures de lecture
Mitteldeutschland war Kerngebiet der Reformation, jenes weltgeschichtlichen Ereignisses im fruhen 16. Jahrhundert, das nicht nur das Zeitalter der Konfessionen einlautete, sondern auch kulturelle, soziale und politische Strukturen nachhaltig veranderte. Die in diesem Buch prasentierten Lebensbilder zeigen anschaulich, dass die Reformation und die Etablierung der Konfessionen auch und gerade das Werk von weniger bekannten Theologen und Personlichkeiten war, und dass der Sieg des Luthertums ganz entscheidend von den Grafen, Fursten und Bischofen der ganzen Region getragen wurde. Es waren vor allem diese Personlichkeiten, die im Mansfelder Land, im Furstentum Anhalt und in den Bistumern Magdeburg und Merseburg fur die Ideen Luthers und Melanchthons eintraten. Ihr Leben pendelte zwischen altem Glauben und reformatorischem Sendungsbewusstsein. Das Buch nimmt dabei nicht nur die "Sieger" dieser grossen Auseinandersetzung um den "wahren" Glauben in den Blick, sondern auch die Anhanger der alten Kirche katholisch gebliebene Landesherren sowie Monche und Ratsherren in der Stadt, die fur eine Erneuerung der alten Kirche stritten. Schliesslich treten Gelehrte und Kunstler, die ihr Schaffen und ihre Forschungen mit einer veranderten politischen und religiosen Umwelt in Einklang zu bringen wussten, in den Fokus der Lebensbilder.