Ulmer Höh'
- 400pages
- 14 heures de lecture

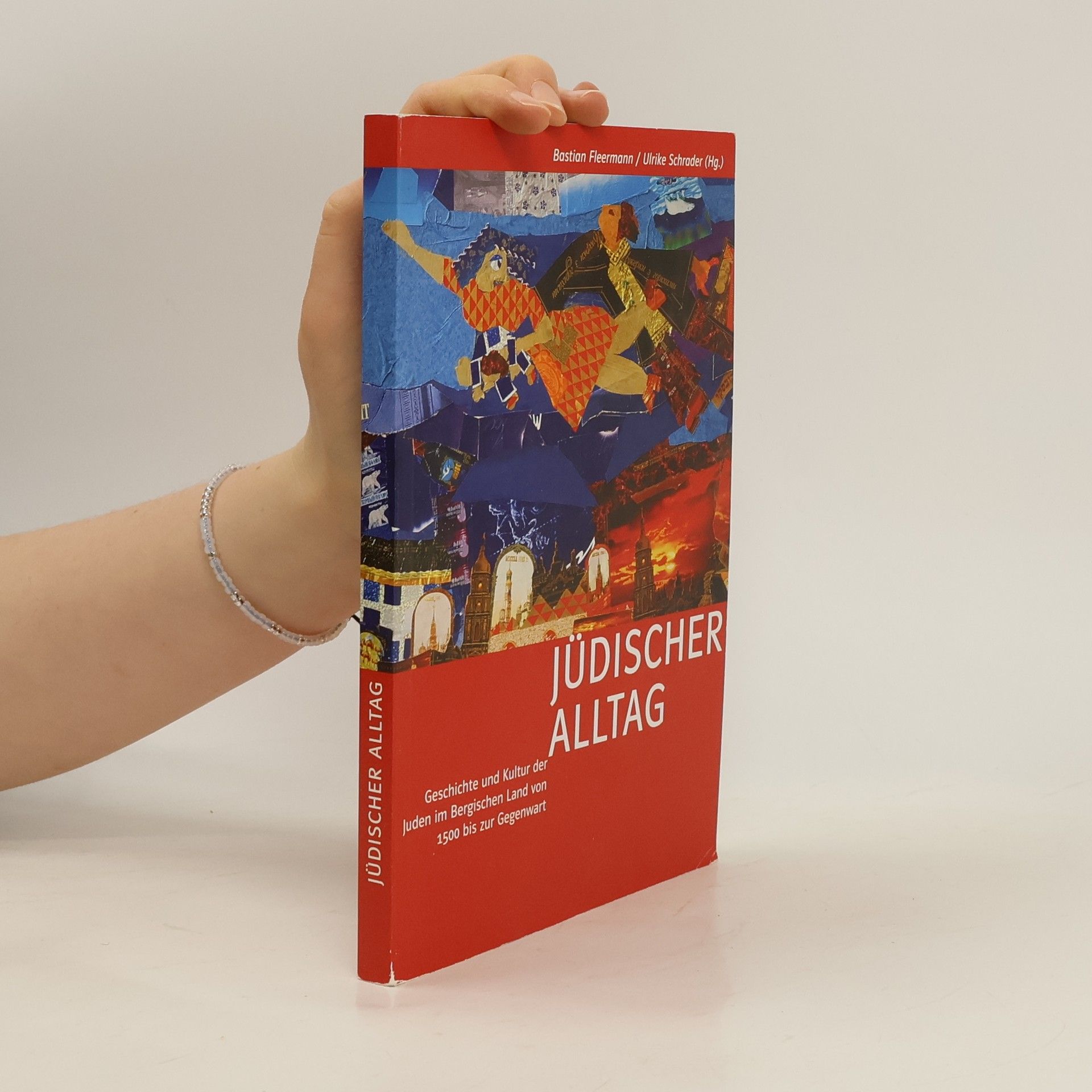



Sinti und Roma in Düsseldorf und im nördlichen Rheinland vom Spätmittelalter bis zum Ersten Weltkrieg
Dieser Band beleuchtet die Geschichte der Düsseldorfer Kriminalpolizei von den 1920er Jahren bis zur Nachkriegszeit. Ab 1936 war die Kripo Düsseldorf als „Kriminalpolizeileitstelle“ für die Verbrechensbekämpfung in der gesamten Region zuständig. Nach 1933 beteiligten sich die Beamten aktiv an den Verbrechen des NS-Regimes, indem sie Menschen als „Asoziale“, „Gemeinschaftsfremde“ oder „Volksschädlinge“ klassifizierten und in Konzentrationslager deportierten. Diese brutale „Reinigung des deutschen Volkskörpers“ wurde nicht nur an der „Heimatfront“ durchgeführt, sondern auch in den meisten besetzten europäischen Gebieten. Die Kommissare, viele von ihnen jahrzehntelang im Dienst, nutzten alle verfügbaren Mittel. Die rasante Modernisierung der Weimarer Zeit, die Anwendung von Naturwissenschaften, umfangreiche Karteien und moderne Kommunikationsmittel waren keine Gegensätze zu dem folgenden Rückfall in Gewalt, sondern vielmehr dessen Voraussetzung. Die Beiträge stammen von verschiedenen Autoren, die unterschiedliche Perspektiven auf diese komplexe Geschichte bieten.