Goethes «Italienische Reise» ist ein Schlüsselwerk der Weimarer Klassik – Flucht aus der Midlife-Crisis, Aufbruch in die Welt, Bildungsreise in die Antike, Selbstverortung des großen deutschen Dichters. Sie ist aber auch der Beginn einer bürgerlichen Tradition: Goethes Bericht nährte eine Rom- und Italienbegeisterung unter deutschen und europäischen Intellektuellen, die bis heute anhält. Golo Maurer zeigt, wie ebenjene Selbsterfahrung Goethes in Italien für die Generationen nach ihm zum Vorbild wurde. Karl Friedrich Schinkel reiste im frühen, Richard Wagner im späten 19. Jahrhundert nach Italien, die Brüder Mann, Walter Benjamin, Sigmund Freud, der sich einen «Italienpilger» nannte – Goethe hatte ihnen die Messlatte gesetzt: «Dem denkenden und fühlenden Menschen geht ein neues Leben, ein neuer Sinn auf, wenn er diesen Ort betritt.» Maurer macht in seinem Buch deutlich: Goethes Italienreise war der erste deutsche Selbstfindungstrip – und als solcher für die Nachgeborenen ästhetischer Topos wie autobiographische Herausforderung.
Golo Maurer Livres
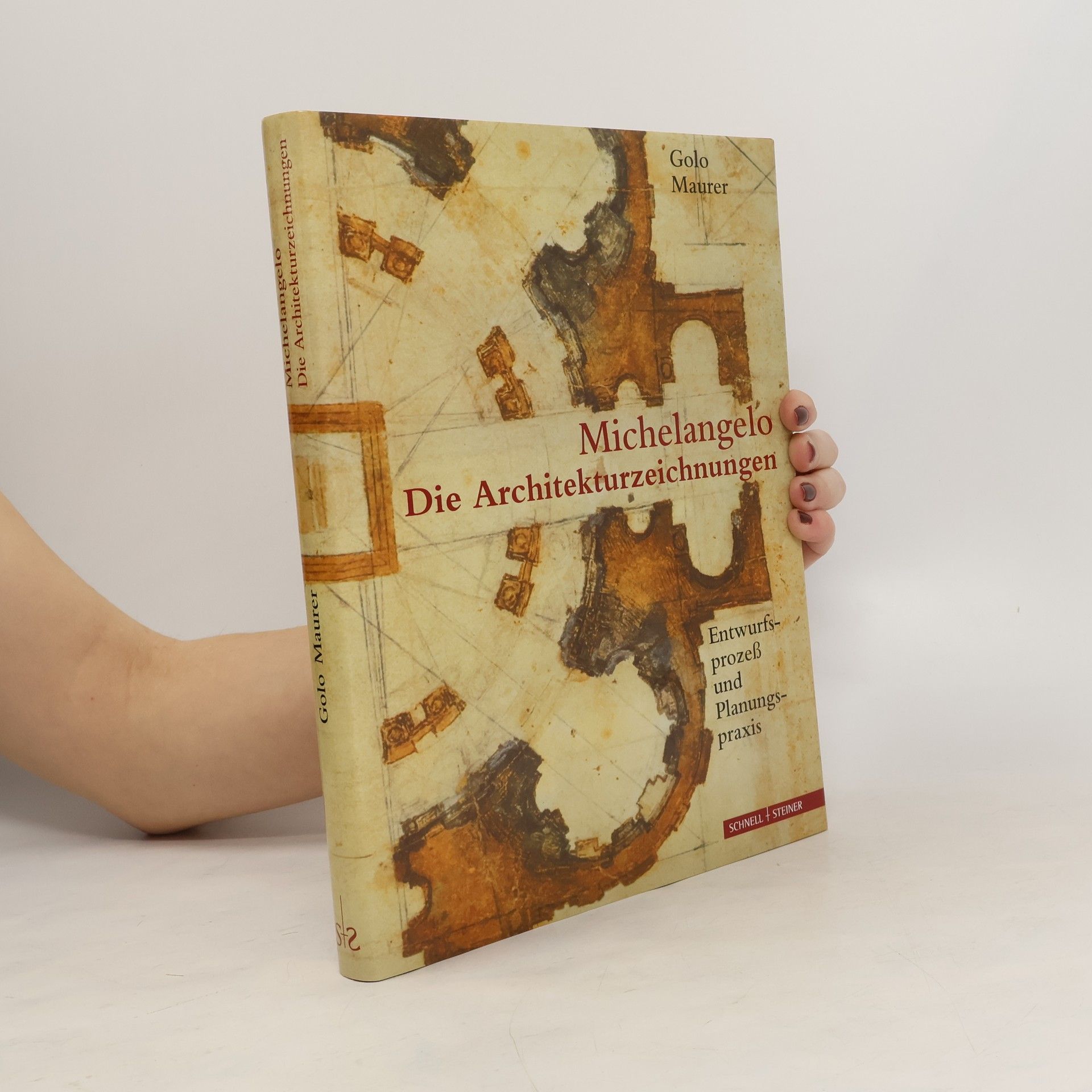


Rom
Stadt fürs Leben
Schön ist es, von Rom zu träumen – aber wie wäre es, dort zu leben? Golo Maurer hat sich genau dazu entschlossen, und er zeigt die Stadt und das römische Leben, fern touristischer Pfade und aus eigener täglicher Erfahrung. Dabei führt der Weg durch sämtliche quartieri und über die berühmten sieben Hügel, am Tiber entlang und ins Gewimmel der Gassen. Was Zugezogene wissen sollten: dass casa weder nur «Wohnung» noch notwendig «Haus» bedeutet; wo-rauf zu achten ist, damit die Spaghetti Vongole so betörend schmecken, wie sie es hier im besten Fall tun; was man über die italienische Politik erfährt, wenn man dem Taxifahrer aufmerksam lauscht. Und damit beginnt schon die Initiation in die römische Lebensart, zu der die Kunst des Fluchens ebenso gehört wie das si sta bene , das die Mentalität der Italiener auf unvergleichliche Weise ausdrückt. Eine leichtfüßige literarische Erkundung, die spüren lässt, wie es ist, in Rom zu leben, vielleicht gar Römer zu werden – und zeigt, was den besonderen Zauber der Ewigen Stadt ausmacht. Ein Stadtverführer für all jene, die Rom wirklich kennenlernen wollen, ob vor Ort oder als Reisende im Geiste.
Michelangelo - die Architekturzeichnungen
- 244pages
- 9 heures de lecture
Obwohl Michelangelo seine Laufbahn als Architekt erst im Alter von über 40 Jahren begann, sind mit seinem Namen berühmte Bauten wie die Medici-Kapelle und die Biblioteca Laurenziana in Florenz sowie die Basilika von Sankt Peter in Rom verbunden. In diesem Buch wird erstmals eine größere Gruppe von Michelangelos Architekturzeichnungen systematisch untersucht. Der Fokus liegt nicht auf seinen vollendeten Bauwerken, sondern auf seiner Entwurfs- und Arbeitsweise. Es ist bemerkenswert, dass der Maler und Bildhauer das Baugeschäft erst mühsam erlernen musste. Die Fortschritte, die in den vollendeten Bauten sichtbar sind, können in den Zeichnungen nachvollzogen werden. Durch die Zusammenführung bisher kaum beachteter Indizien und den Vergleich mit den Methoden seiner Zeitgenossen entsteht ein neues Gesamtbild des Architekten Michelangelo. Der Vergleich zeigt, dass er ein „Künstler zwischen den Epochen“ war, der mit traditionellen und manchmal mittelalterlichen Methoden seine innovativen Entwürfe umsetzte. Die Rekonstruktion seines Entwurfsprozesses führt zu übergreifenden Fragen der Michelangelo-Forschung: Die Entwicklung seines architektonischen Stils, das Verhältnis von Regel und Augenmaß sowie die Bewertung des Bildhauerischen in der Architektur erfahren eine neue Beurteilung im Kontext der erschlossenen Quellen.