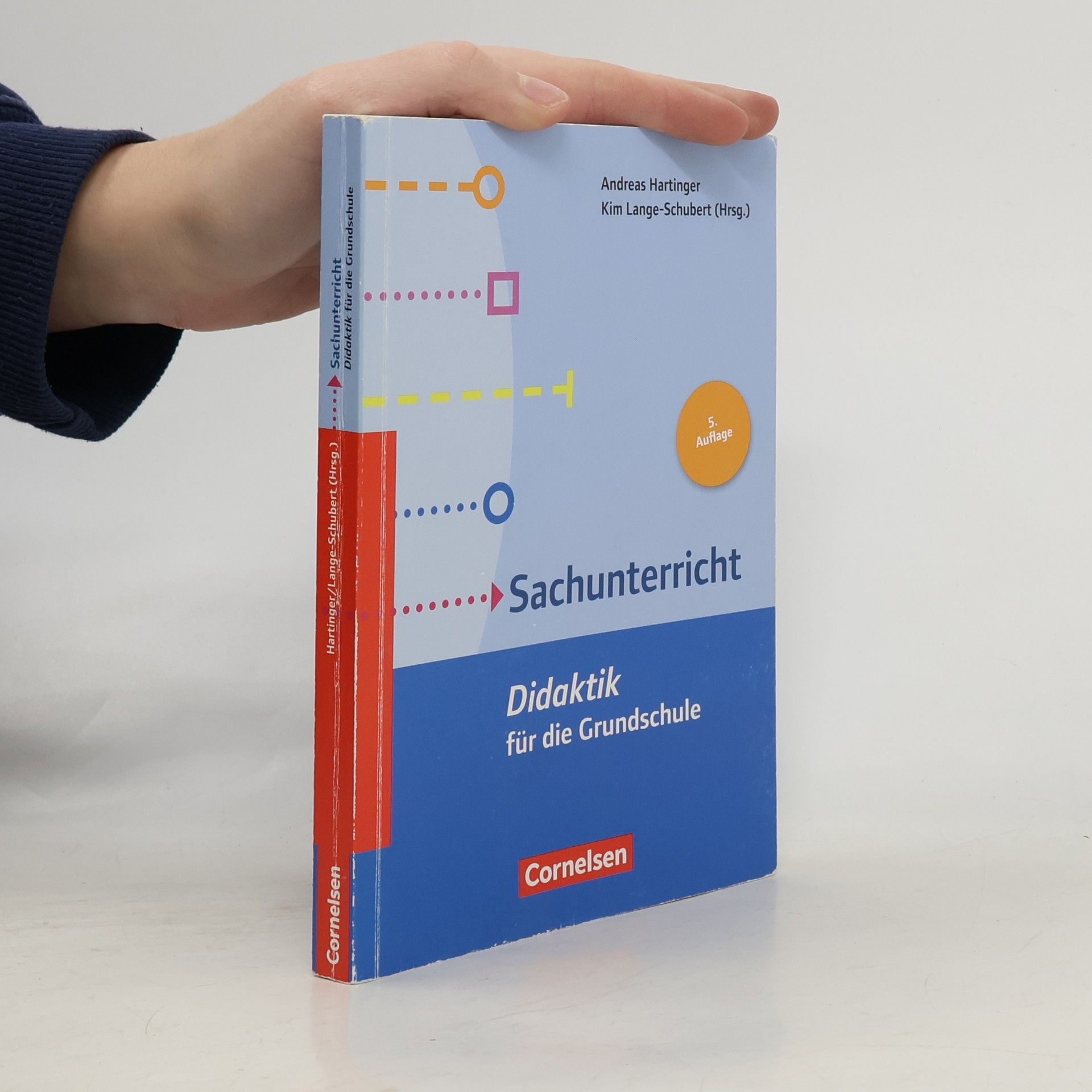Themen: inklusives Lernen und Sexualbildung. Alle weiteren Themen sind aktualisiert und auf dem neuesten Stand - natur- und sozialwissenschaftliches Lernen, geografische, historische und technische Lernaspekte, Mobilitätsbildung und Bildung zu nachhaltiger Entwicklung, Friedens-, Medien und Gesundheitserziehung, Leistungsbeurteilung und Lehrerprofessionalität. Für angehende oder praktizierende Lehrer/-innen.
Markus Peschel Livres