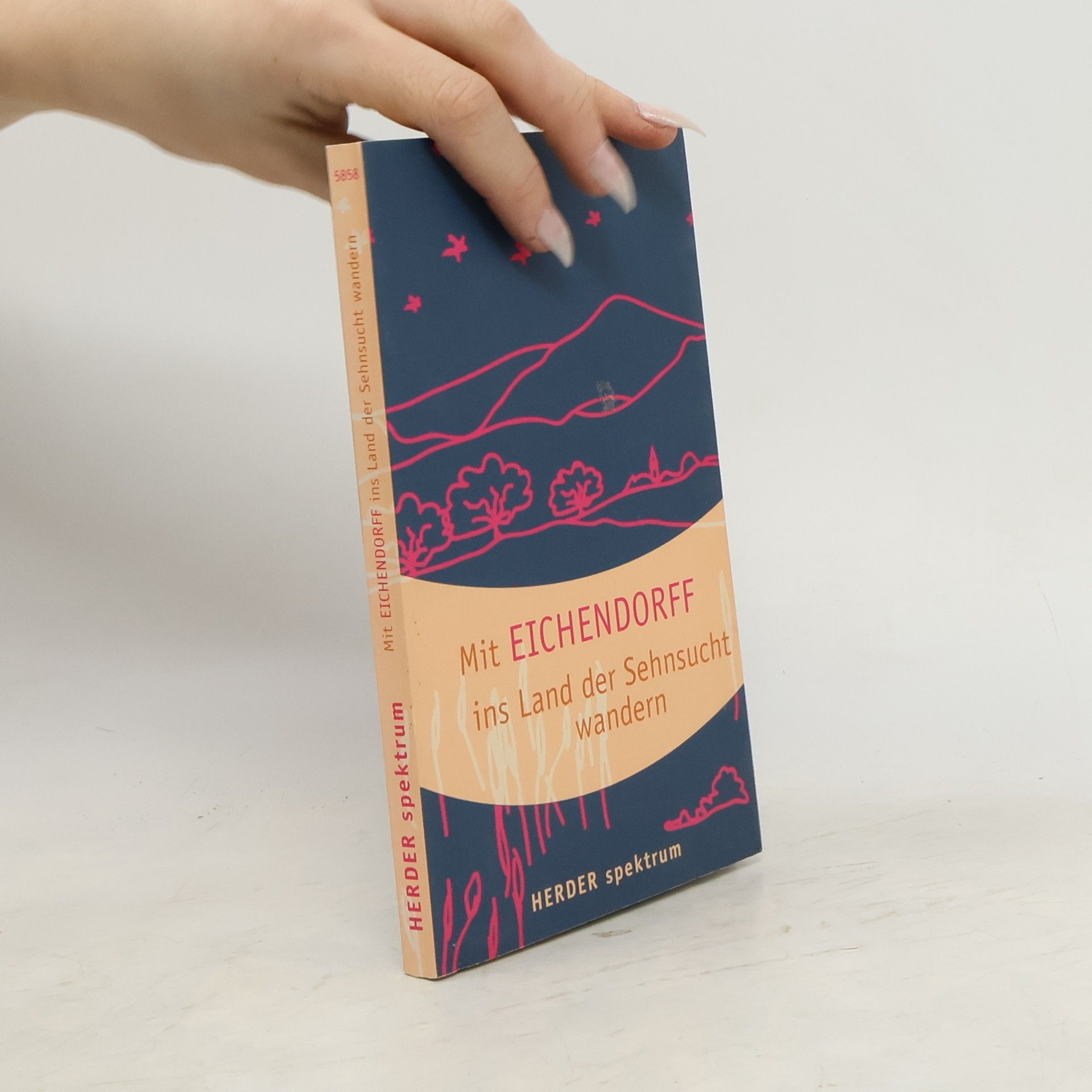Eichendorffs Texte wecken Herzklopfen und Sehnsüchte und berühren die Seele ähnlich wie Bob Dylans Werke. Sie sind tiefgründig und einfach, wie in einem Abendgedicht, das von der Sehnsucht nach Heimat und Freiheit erzählt.
Christoph Bartscherer Livres