Das verschwundene Leipzig
Das Prinzip Abriss und Neubau in drei Jahrhunderten Stadtentwicklung

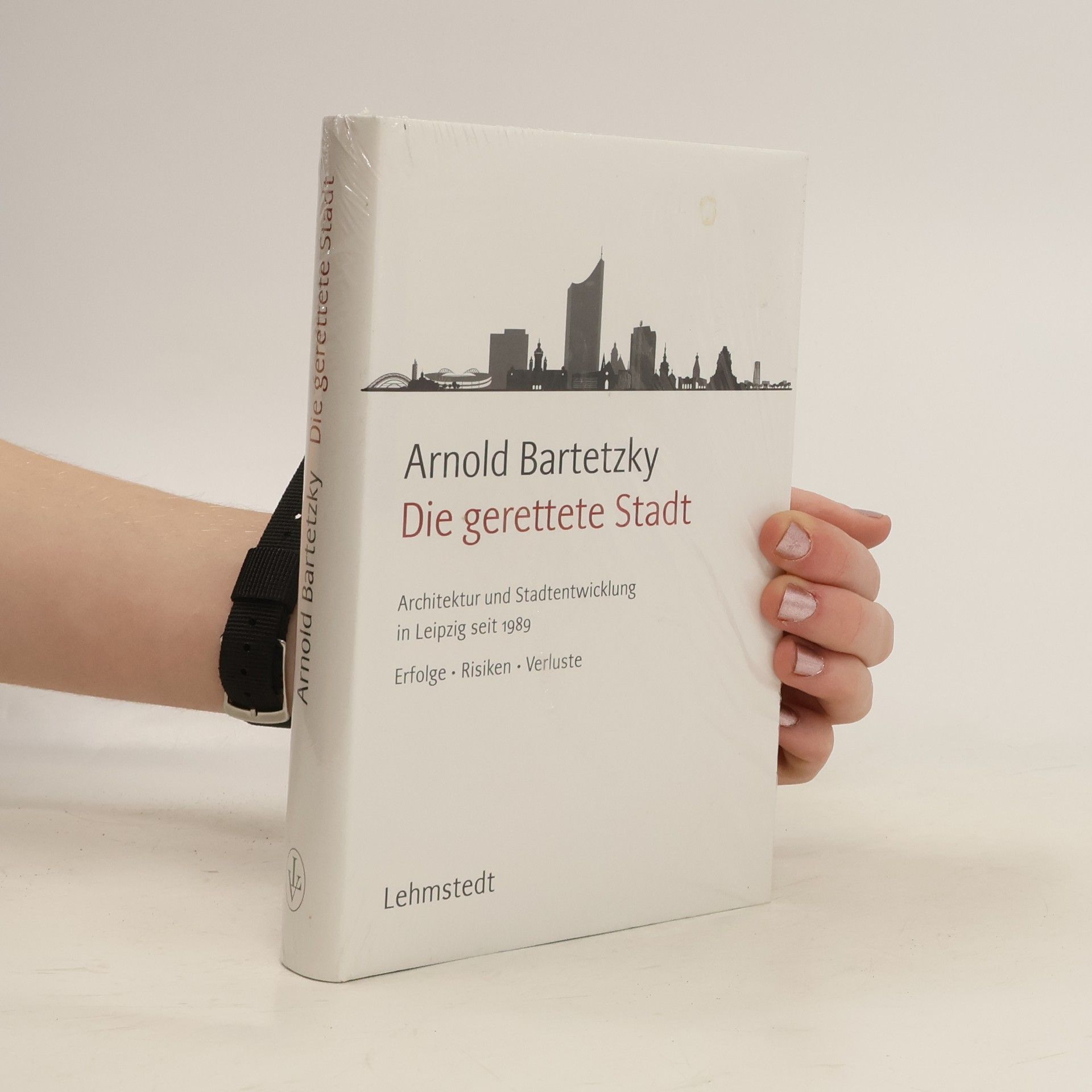



Das Prinzip Abriss und Neubau in drei Jahrhunderten Stadtentwicklung
Stimmen und Erinnerungen aus vier Jahrzehnten
Projekte, Visionen, Luftschlösser
In der späten DDR-Zeit symbolisierte der Verfall Leipzigs den Niedergang ostdeutscher Städte. Die Frage 'Ist Leipzig noch zu retten?' prägte nicht nur die lokalen Debatten, sondern erregte auch bundesweit Aufmerksamkeit. Leipzig wurde gerettet, jedoch verlief die Entwicklung unregelmäßig. In den frühen 1990er Jahren galt die Stadt als Boomtown des Ostens, nur um kurz darauf als Paradebeispiel einer Schrumpfstadt und Abrisshauptstadt Deutschlands traurige Berühmtheit zu erlangen. Doch der Wandel ließ nicht lange auf sich warten: Leipzig begann wieder zu wachsen, neue Industriebetriebe siedelten sich an, und Bau- sowie Sanierungstätigkeiten nahmen zu. Heute wird Leipzig, trotz anhaltender Probleme und Risiken, als eine der attraktivsten Großstädte Deutschlands angesehen und gilt als Musterbeispiel erfolgreicher Stadtentwicklung. Nirgendwo sonst in Ostdeutschland lassen sich die Höhen und Tiefen, Chancen und Gefahren der nachwendlichen Stadtentwicklung so anschaulich verfolgen wie hier. Arnold Bartetzky, ein erfahrener Beobachter des Leipziger Baugeschehens, beschreibt den Weg seit 1989 mit großer Sachkenntnis und Präzision. Dr. Bartetzky, geboren 1965, hat Kunstgeschichte, Germanistik und Philosophie studiert und ist seit 1995 am Geisteswissenschaftlichen Zentrum in Leipzig tätig, zudem als Architekturkritiker aktiv.