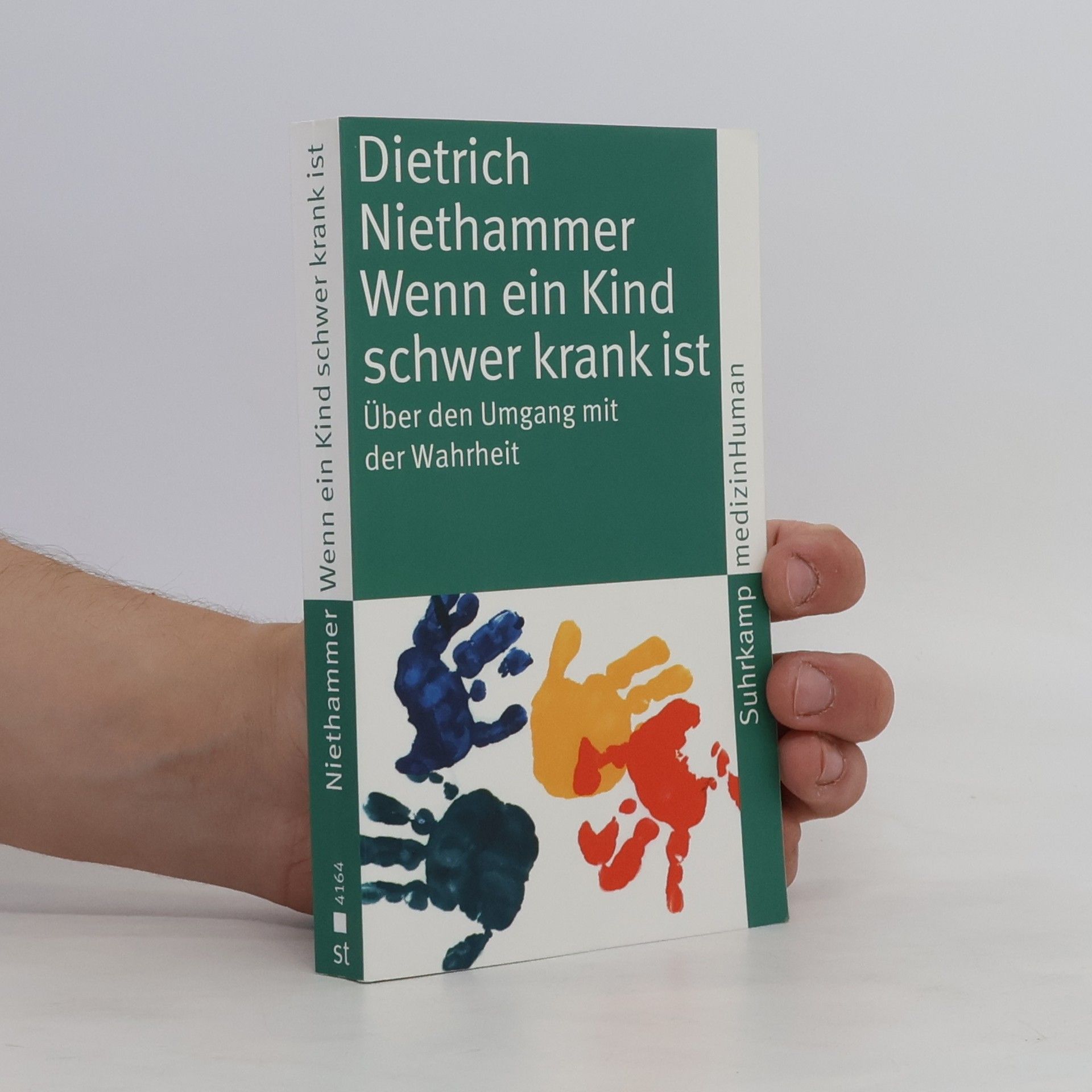Wenn ein Kind schwer krank ist
Über den Umgang mit der Wahrheit
Noch heute ist man der Ansicht, schwerkranke Kinder und Jugendliche vor dem Wissen um ihre Krankheit oder ihren bevorstehenden Tod schützen zu mssen. Die Folgen dieser »Rücksichtnahme«, dieser oft hilflosen Täuschungsversuche von Ärzten und Eltern, sind allerdings erschütternd: Der Kontakt zu den jungen Patienten bricht ab, sie ziehen sich in sich selbst zurück und sterben einsam. Obwohl sie ohnehin wissen, wie es um sie steht, weil sie die Zeichen zu deuten verstehen, werden sie allzu oft mit diesem Wissen allein gelassen.