Eine herzbrechende Liebeserklärung an ein verschwindendes Medium. David Wagner beschreibt Michael Angeles Betrachtungen über den letzten Zeitungsleser. Nicht jeder Zeitungsleser ist so fanatisch wie Thomas Bernhard, der für einen Artikel in der NZZ 350 Kilometer zurücklegte. Dennoch empfinden viele eine ähnliche Abhängigkeit, wenn keine Zeitung zur Hand ist. Die Vielfalt der deutschsprachigen Zeitungslandschaft und die Tageszeitung selbst scheinen jedoch nicht zu retten zu sein, was zu einem Verlust führt. Michael Angele, ehemaliger Chefredakteur einer Internetzeitung, blickt wehmütig auf das Verschwinden einer Kulturleistung und Lebensform zurück. Dies beginnt bei den Ritualen des Zeitungslesens und der Umgebung, in der man dies tut, bis hin zu den Kommunikationsdynamiken, die durch das Blatt am Frühstückstisch entstehen. Manche Beziehungen wären ohne die Zeitung ganz anders verlaufen. Auch das Gefühl von Weltläufigkeit wird in Frage gestellt, wenn man in einer New Yorker Hotellobby am Handy liest, anstatt die New York Times zu genießen. Mit Herzblut und Scharfsinn verfasst, hat Michael Angele mit seinen Überlegungen zur Lebensform Zeitung ein eindrucksvolles Denkmal gesetzt, das bleibt, selbst wenn das letzte Exemplar einer gedruckten Zeitung vergilbt und zerfällt.
Michael Angele Livres

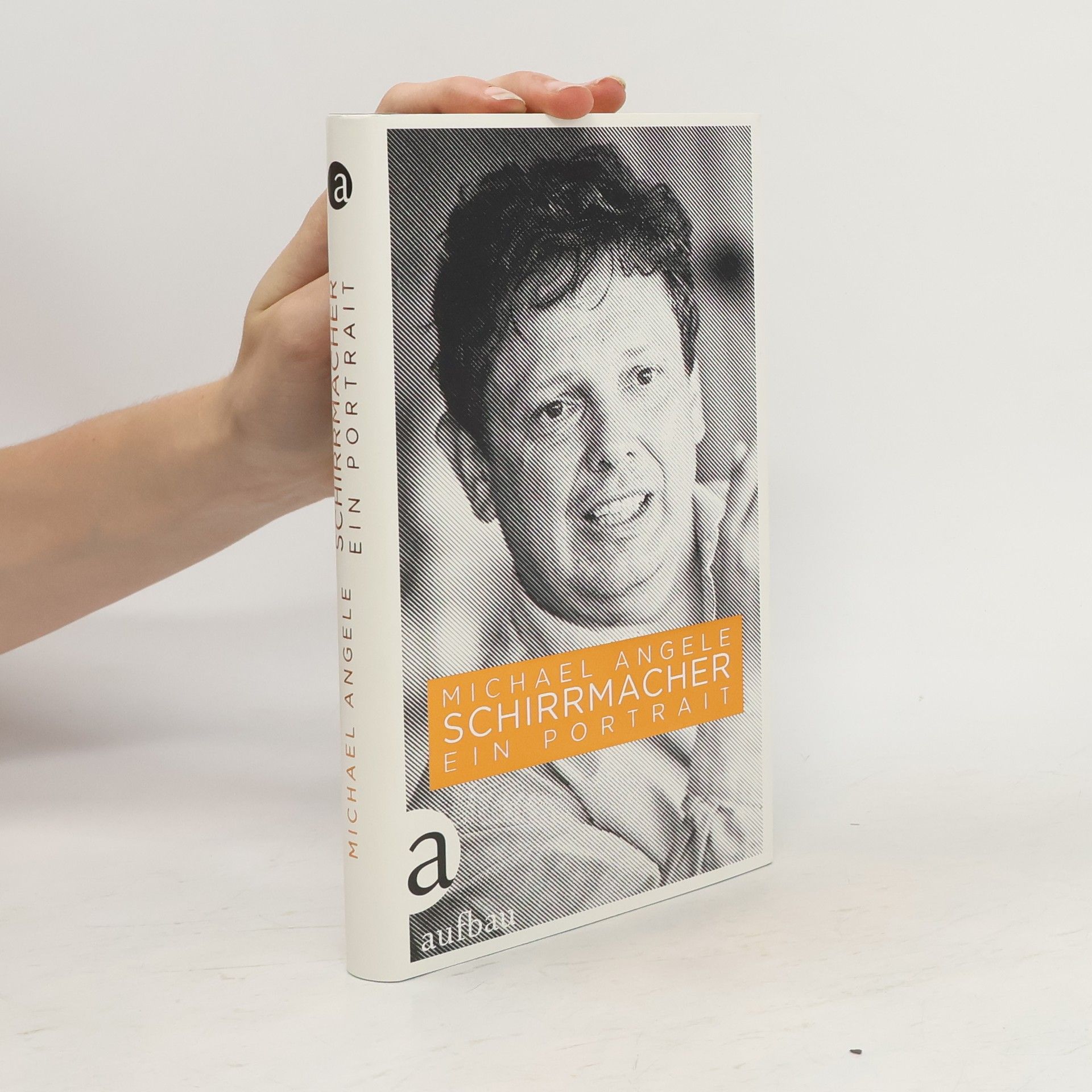
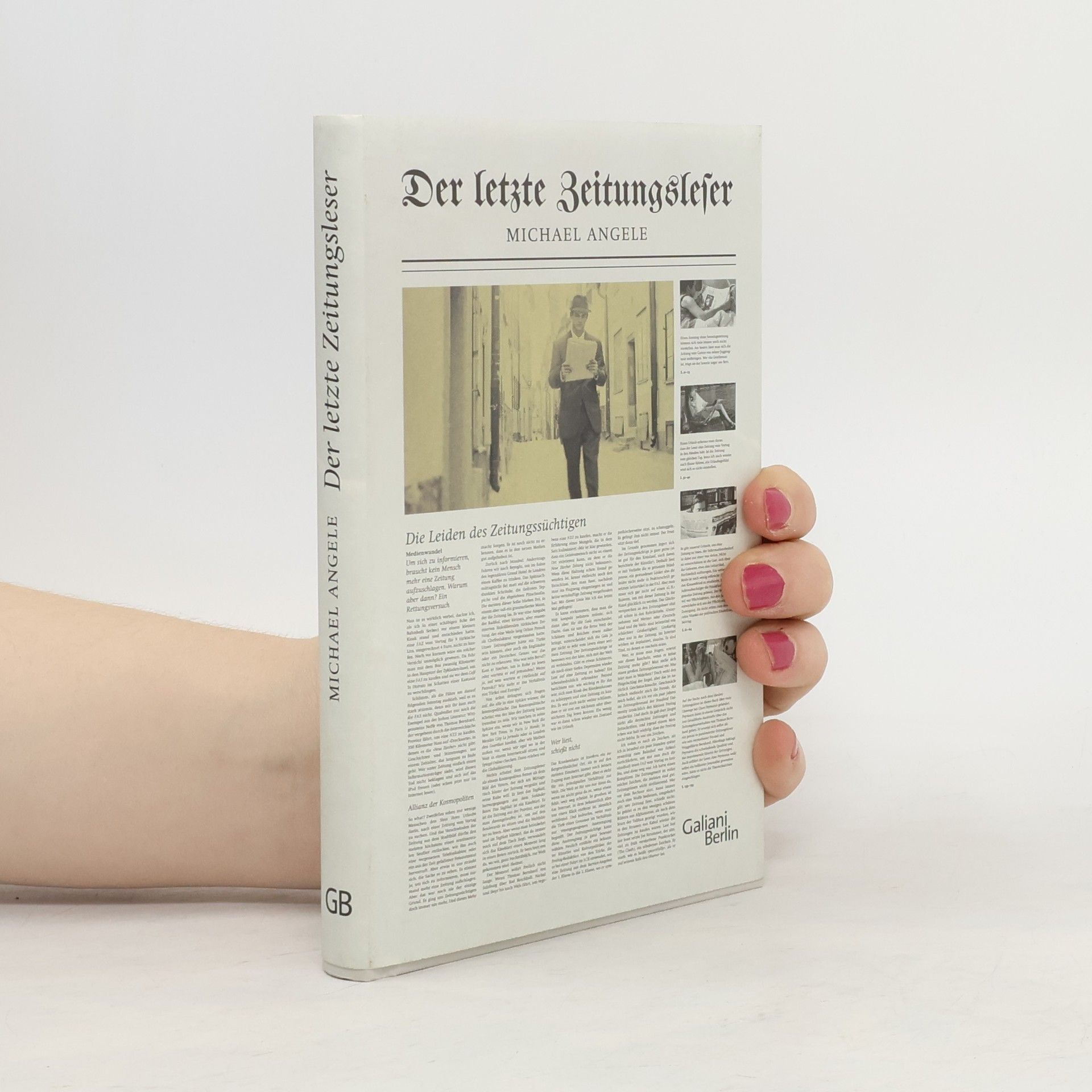
Das Spiel mit der Macht. Frank Schirrmachers Biographie ist vielleicht die letzte, die man exemplarisch nennen muss: Michael Angele hat das erste Porträt des großen Journalisten, Herausgebers der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und Bestsellerautors geschrieben. Er zeichnet ein detailreiches Bild des Mannes, den man den „kindlichen Kaiser“ nannte, ebenso wie ein Panorama der Medienlandschaft und Debatten dieser Zeit, die Schirrmacher entscheidend mitbestimmte. In der deutschen Mediengeschichte ist Frank Schirrmacher (1959--2014) eine singuläre Erscheinung. Weit über seine Funktion als Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hinaus wirkte Schirrmacher als Bestsellerautor in die deutsche Öffentlichkeit und ihre Debatten hinein. Dabei verschränkten sich Machtwille und Lust am Diskurs, Aufklärung und Reaktion in spektakulärer Form. Schon zu Lebzeiten wurde er bei Eckhard Henscheid oder Rainald Goetz zur literarischen Figur, nicht zuletzt wegen seines Hangs zur Intrige und zur großen Geste. Schirrmacher, der Beamtensohn aus Wiesbaden, aufgewachsen als Anhänger von Thomas Mann und Helmut Kohl, endete als globaler Nerd des 21. Jahrhunderts, der sich im digitalen Kosmos wohler fühlte als in den deutschen Salons. Am 12. Juni 2014 starb er überraschend an Herzversagen. „Über Schirrmacher schreiben heißt, ein Schelmenstück schreiben. Es ist das Stück, in dem er sich selbst sah.“ (Michael Angele)
In den legendären 20er Jahren wurde Berlin zur kulturellen Hauptstadt Europas, wo Literaten die freizügige Atmosphäre für ihre kreative Arbeit fanden. Namen wie Gottfried Benn, Alfred Döblin, Else Lasker-Schüler, Franz Kafka und Vladimir Nabokov prägten diese Zeit. Sie lebten und arbeiteten in der Stadt, besuchten Cafés und unternahmen literarische Streifzüge. Diese Tradition wurde durch die deutsche Teilung unterbrochen, während Bertolt Brecht und Christa Wolf im Ostteil der Stadt lebten, während Uwe Johnson, Günter Grass und Max Frisch das Leben in West-Berlin bevorzugten. Ende der 80er Jahre verfolgte Cees Nooteboom die Wiedervereinigung. Heute ist Berlin erneut ein Zentrum für Presse, Film, Fernsehen und junge Schriftsteller. Das Buch zeigt Berlin, wie es einst war und wie es heute ist, und bietet dabei unerwartete Perspektiven. Der Autor und Fotograf erkunden die große literarische Geschichte der Stadt und spannen den Bogen von den Salons bis zur zeitgenössischen Dichterszene am Prenzlauer Berg, von Theodor Fontane bis Judith Hermann.