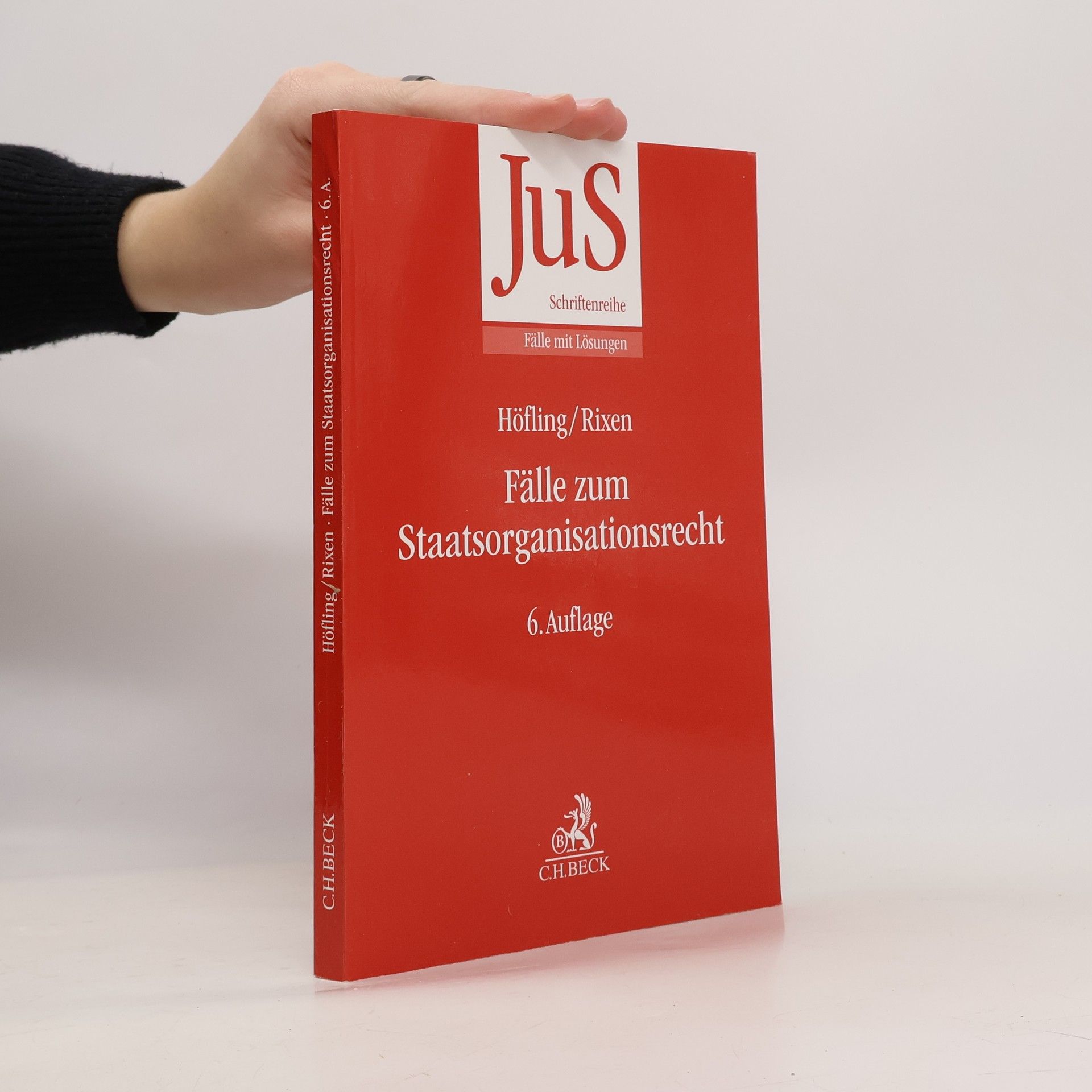Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen
(Prostituiertenschutzgesetz - ProstSchG)
Zum WerkDas Prostituiertenschutzgesetz soll nach dem Willen des Gesetzgebers das 2002 eingeführte Prostitutionsgesetz (ProstG) ergänzen und dessen Durchschlagskraft verbessern. Es hat dabei erhebliche Auswirkungen auf die Prostituierten durch Anmeldeverpflichtungen und gesundheitliche Auflagen. Insgesamt wird der Zugang von Frauen und Männern in der Prostitution zu Unterstützungs- und Beratungsangeboten gestärkt.Aufgrund der hohen und detaillierten Regelungsdichte des Gesetzes mit erheblichem Verwaltungsaufwand bei Gesundheits- und Ordnungsbehörden sowie der Polizei ist eine umfassende, aber zugleich kompakte Kommentierungen der Bestimmungen erforderlich.Vorteile auf einen Blick umfassende Kommentierung des Gesetzes Berücksichtigung sämtlicher Gesetzesänderungen verwaltungsrechtlicher Schwerpunkt, der aber die betroffenen Personen nicht aus dem Blick lässt ZielgruppeFür Rechtsanwaltschaft, Verwaltungsrichterschaft, Verwaltungsbehörden im Bereich Gesundheitsschutz und Prostituiertenschutz.